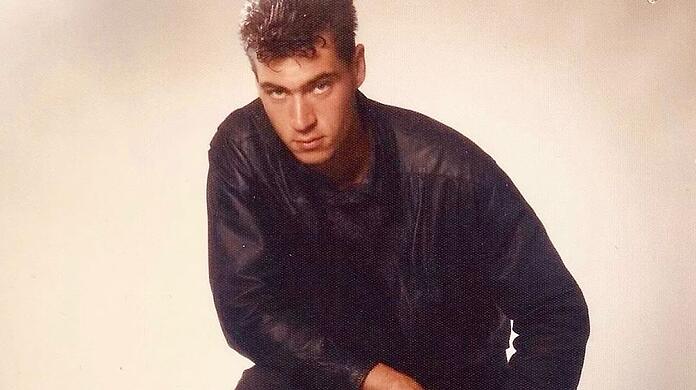So will Bayern gegen Fake News vorgehen
München - "Eine staatliche Elite entführt und foltert Kinder, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen." "Hillary Clinton hat in einer Pizzeria einen Kinderpornoring" - man fragt sich, wie solche hanebüchenen Geschichten entstehen und sich verbreiten. Und warum Menschen daran glauben.
"Digitale Blasen aufpiksen"
Doch Fake News, also Falschnachrichten, bis hin zu Desinformationskampagnen sind trotz Pressefreiheit keine Seltenheit in Deutschland. Vor der Europawahl will daher Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (FW) ein Bündnis gründen, um dagegen vorzugehen.
Sein Credo: die digitalen Blasen aufpiksen, in denen Falschnachrichten entstehen.
Falschnachrichten und gezielte Desinformation
"Auf Fake News kann man überall treffen, sowohl im Netz als auch privat", sagt Dominik Bär. Er forscht an der LMU zu "harmful content", also Hassnachrichten und Fake News, sowie zu politischer Werbung in Sozialen Medien.
Der Unterschied zu Desinformationskampagnen sei, dass diese bewusst irreführende und falsche Inhalte teilen mit dem Ziel, Menschen vorsätzlich zu beeinflussen oder zu täuschen.
Wenn Politiker nicht die Wahrheit sagen
Ein ganzes Sammelsurium an Akteuren steckt dahinter: "Bei der Wahl 2016 in den USA wurde vor allem der Einfluss russischer Akteure stark diskutiert", sagt Bär. Aber auch China und Iran würden zum Teil solche Strategien nutzen.
Man müsse aber gar nicht so weit gehen. "Politiker und Politikerinnen in Deutschland sagen auch ab und zu nicht die ganze Wahrheit oder lassen bewusst Informationen weg." Besonders die politischen Extreme nutzen diese Wege, so Bär.
Das Entwurmungsmittel gegen Corona
So seien zur Abschaltung der Atomkraftwerke immer wieder Falschnachrichten verbreitet worden, aber Bär nennt auch das Beispiel der Entwurmungsmittel für Pferde, das laut dem österreichischen FPÖ-Chef Herbert Kickl gegen Corona helfen sollte.
Hat das Spiel mit den Grenzen auch für Parteien an Fahrt aufgenommen? Bär vermutet, dass es eher am leichten und unmittelbaren Zugang liegt, den es heute in der Politik gibt: "Früher haben Politiker mit den Medien gesprochen, heute sprechen sie potenzielle Wähler direkt über Social Media an."
Insofern sei der Filter weg. Hinzu komme, dass sich die Grenzen des politisch Sagbaren in den letzten Jahren verschoben haben, findet Bär.
Viele Menschen fragen sich: Warum glauben Personen absurde Dinge, die im Internet stehen, und verbreiten sie gar noch? Bär erklärt die Durchschlagskraft von Fake News und solchen Kampagnen damit, dass man dank Internet Informationen leichter teilen könne, aber auch weil andere Medien an Relevanz verloren haben.
Fake News setzen auf Emotionen
Besonders ein Faktor sei zentral: "Wir sehen in unserer Forschung, dass Nachrichten, die besonders emotional sind, sich besonders gut verbreiten", sagt Bär. Emotionen werden bewusst eingesetzt, um Menschen zu triggern.
Hinzu komme der "Confirmation Bias" (Englisch: Bestätigungsfehler): "Menschen glauben gerne an Dinge, die ihre eigene Überzeugung bestätigen." Doch teils sei es auch schlicht das Phänomen, etwas schnell aufzuschnappen - sich nicht tief mit etwas zu beschäftigen.
Der Aufwand, Falschnachrichten zu verbreiten, hält sich in Grenzen. Programmiert seien Falschnachrichten relativ schnell - wenn es um einfache Nachrichten gehe. "Bei überlegten oder strategischen Kampagnen ist das anders", sagt Bär.
Die Professionalität hat auch Mehring schon verblüfft. "Viele aus meinem Stimmkreis haben mich auf Fehlentscheidungen in der Corona-Pandemie hingewiesen, das hätten sie in den Nachrichten gesehen." De facto sei es aber eine Sendung gewesen, die wie die Tagesthemen aufgemacht war. Nur eben mit Falschnachrichten.
Wie tracken?
Das Fatale: Erst wenn sie sich ausgebreitet und eine gewisse Reichweite haben, bemerkt man diese Kampagnen, erklärt Bär.
Mehring hat deshalb schon mit Deutschlands Google-Entwicklungschef gesprochen, aber auch Vereine, Kirchen und Verbände will er unter anderem in sein Bündnis einbinden.
Benjamin Adjei, Sprecher für Digitales und Europa der Landtags-Grünen, hält das Bündnis für "wenig zielführend". Denn: "Absichtserklärungen von Tech-Plattformen halten oftmals nicht, was sie versprechen - das haben die letzten Jahre leider gezeigt", sagt Adjej.
Kommt die Kampagne zu spät?
Zumal die Ankündigung zwei Monate vor der Wahl zu spät sei. Ähnlich sieht das Digitalexperte Bär, zumal man schon sehr lange im Gespräch mit den Plattformen sei. Er hält das Bündnis ebenfalls für einen "zahnlosen Tiger". Gut findet er hingegen, dass es Aufklärungskampagnen geben soll - "aber die müssten schon früher und größer eingesetzt werden".
Mehring sagt im Gespräch mit der AZ, dass es mit Blick auf die Europawahl "sportlich" werde. "Das ist der Aufhänger, um das zu starten." Man müsse aber in der ganzen Legislaturperiode "die Blasen aufpiksen".
Adjej kritisiert außerdem, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) es selbst mit der Wahrheit nicht so genau nähmen: "Das Problem sitzt mit am Kabinettstisch."
Grünen-Antrag abgelehnt
Die Grünen würden schon sehr lange ein Vorgehen gegen Fake News fordern, erst in der vergangenen Woche sei aber im Landtag wieder ein Antrag zur besseren Erforschung von Fake News von den Regierungsfraktionen abgelehnt worden.
Wenn sich die Politik schon dazu nicht einig wird, was bleibt dann noch? "Community Notes" setzen auf X Nachrichten in einen Kontext. Das heißt, die Nutzer identifizieren Fake News und ordnen diese für andere Nutzer ein.
Zudem können die Plattformen auf "accuracy nudges" setzen, die Nutzer daran erinnern Inhalte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, bevor diese geteilt werden, erklärt Bär.
KI ermöglicht vieles
Künstliche Intelligenz (KI) ermögliche es, bessere gefakte Bilder und Videos zu erstellen. "Das geht heute deutlich leichter als vor wenigen Jahren", sagt Bär. Aber KI könne man eben beispielsweise auch nutzen, um Hassnachrichten zu erkennen. "Nur müsste man versuchen, das noch mal zu verifizieren. Bei automatischem Löschen von Inhalten besteht sonst die Gefahr, in die freie Meinungsäußerung einzugreifen, was wiederum Misstrauen auslösen könnte."
Was also tun? Als Privatperson kann man sein Feed umstellen und nur Beiträge von Seiten, denen man selbst folgt, sehen - so denn diese Nachrichten stimmen, schränkt Bär ein. Sich mit Hilfe verschiedener Quellen, wie Zeitungen oder anderen Medien, zu informieren, ist eine Methode, die Bär selbst nutzt.