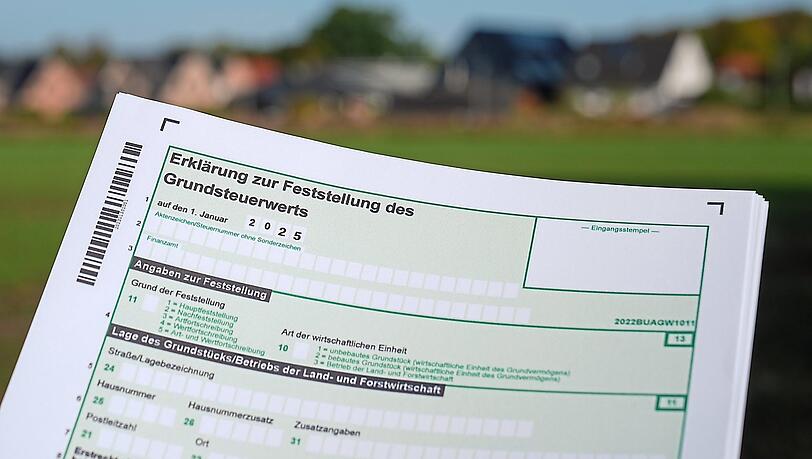Grundsteuer-Schock in Bayern: So viel müssen Hausbesitzer ab 2025 mehr zahlen
München - Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte es kommen sehen. Obwohl für die Erhebung der reformierten Grundsteuer nicht verantwortlich, brandet bei ihm der Ärger von Bürgern an, die ab 2025 zum Teil sehr viel mehr für ihr bebautes Grundstück abdrücken müssen.
Grundsteuer berechnet sich nach der Fläche
Zu den Mysterien der Reform gehört es, dass andererseits auch viele Bürger entlastet werden müssten. Doch die verhalten sich offenbar still. Seit fünf Jahren steht fest, dass in Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Grundsteuer neu errechnet werden muss. Bayern hat sich für eine eigene Lösung entschieden, die sich im Wesentlichen nicht nach dem Verkehrswert des Grundstücks, sondern nach der Fläche richtet.
Besitzer einer Eigentumswohnung mit geringem Bodenanteil müssten demnach entlastet werden, während die Eigentümer großer Grundstücke stärker zur Kasse gebeten werden.
"Wer bisher zu wenig bezahlt hat, muss mehr bezahlen"
"Wer bisher zu wenig bezahlt hat, muss mehr bezahlen", fasst Achim Singh, Sprecher des Bayerischen Städtetags, zusammen. Die Grundsteuer fließt ausnahmslos den Gemeinden zu, die auch für den Erlass der Grundsteuerbescheide zuständig sind. Trotz der langen Vorlaufzeit haben die meisten bayerischen Grundbesitzer noch keinen Bescheid in den Händen.
Wo dies aber der Fall ist, gibt es oft Ärger. Der noch bis vor Kurzem amtierende Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sowie die bayerische Staatsregierung haben an die Kommunen appelliert, die Grundsteuerreform nicht für einen zusätzlichen Schluck aus der Pulle zu missbrauchen. Die Einnahmen aus dieser Steuer sollten die Städte und Gemeinden daher "aufkommensneutral" gestalten.
Klamme Kassen in den Kommunen
Vorschreiben können Bund und Land das den Kommunen nicht. Wegen der vielerorts klammen Gemeindekassen würde so manche Kommune den Grundsatz der Aufkommensneutralität wohl missachten, befürchten Haus- und Grundbesitzerverbände – und fühlen sich durch die bisher bekannt gewordenen Bescheide bestätigt. Von vornherein klar war, dass ein Einfamilienhaus auf einem großen Gartengrundstück sehr viel teurer werden würde, eine Eigentumswohnung müsste nach dieser Logik hingegen weniger Grundsteuer auslösen.
Bürger bekommen gefühlt bislang nur Erhöhungen
Gefühlt werden von den Bürgern bislang aber nur die Erhöhungen. Das kann eigentlich nicht sein, rechnet zum Beispiel die Stadt Würzburg vor, die ihre Bescheide bereits für etwa 50.000 Grundstücke erlassen hat. In 4400 Fällen steige die Grundsteuer zwar "um mehr als 100 Prozent", bei 23.900 Veranlagungen sei hingegen ein Rückgang von mehr als 50 Prozent feststellbar.
Der Würzburger Stadtrat darf sich als Vorbild in Sachen Bürgerfreundlichkeit fühlen. Die künftigen Grundsteuereinnahmen seien durch die Anhebung des Hebesatzes auf 510 Prozent so kalkuliert, dass sie ab 2025 eine bis 1,8 Millionen Euro unter dem bisherigen Aufkommen von 25 Millionen Euro bleiben, teilte die Stadt mit. Der Stadtrat sei auch nicht der Empfehlung des bayerischen Städtetags gefolgt, bei der Neufestsetzung des Hebesatzes einen "Puffer" beziehungsweise "Aufschlag" einzukalkulieren. Dieser "Puffer" könnte vielerorts erklären, warum die Grundsteuereinnahmen nach der Reform eben doch höher sind als vorher.
Einnahmen liegen letztendlich doch höher als bisher
Angehoben werden jedenfalls fast überall die Grundsteuer-Hebesätze, welche ausschlaggebend für die konkrete Steuerforderung sind: in Straubing beispielsweise von 390 auf 420 Prozent, in Aschaffenburg von 400 auf 430 Prozent und in München sogar von 535 auf 824 Prozent. Alle drei Kommunen bekräftigen auf Nachfrage, das Grundsteueraufkommen werde insgesamt nicht steigen.
Das stimmt freilich nur eingeschränkt. Denn außer Würzburg und Aschaffenburg sind die genannten Städte dem "Anraten" des Städtetags gefolgt, bei der Berechnung einen bis zu fünfprozentigen "Risikopuffer für fehlende oder fehlerhafte Messbescheide" einzuplanen. Mit anderen Worten: Die Hebesätze wurden so kalkuliert, dass die Einnahmen letztlich doch um einiges höher liegen als bisher.
348 Millionen Euro sind in München eingeplant
2023 nahm die Stadt München 340 Millionen Euro an Grundsteuer ein, nach der Erhöhung des Hebesatzes sind 348 Millionen Euro im Haushaltsplan der Landeshauptstadt vorgesehen – eine Steigerung von 2,4 Prozent. Die Münchner Grundeigentümer warten immer noch auf die Bescheide für 570.000 Grundstücke. Das Vertrauen auf die Verlässlichkeit der von den Finanzämtern mitgeteilten Grundsteuermessbeträge scheint aufseiten der Kommunen begrenzt zu sein.
Mehr Transparenz ist in Bayern nicht zu erwarten
Für die meisten Bürger ist das Steuerfestsetzungsverfahren ohnehin eine "Black Box", der äußerstes Misstrauen entgegengebracht wird. Mehr Transparenz ist in Bayern auch nicht zu erwarten, wie das dem Finanzministerium untergeordnete Landesamt für Steuern erkennen ließ. Die Finanzämter seien an den von den Kommunen festgelegten Hebesätzen nicht beteiligt, so eine Sprecherin der Behörde: "Im Bereich des Finanzressorts liegen demnach auch keine entsprechenden Informationen vor."
Das Finanzministerium von Baden-Württemberg veröffentlicht auf seiner Website hingegen ein Transparenzregister zu den neuen Hebesätzen der neuen Grundsteuer. Es zeigt, wie hoch der Hebesatz von einer bestimmten Kommune festgesetzt werden müsste, um aufkommensneutral zu sein.
- Themen:
- Albert Füracker
- Bayern
- CSU
- Christian Lindner
- FDP