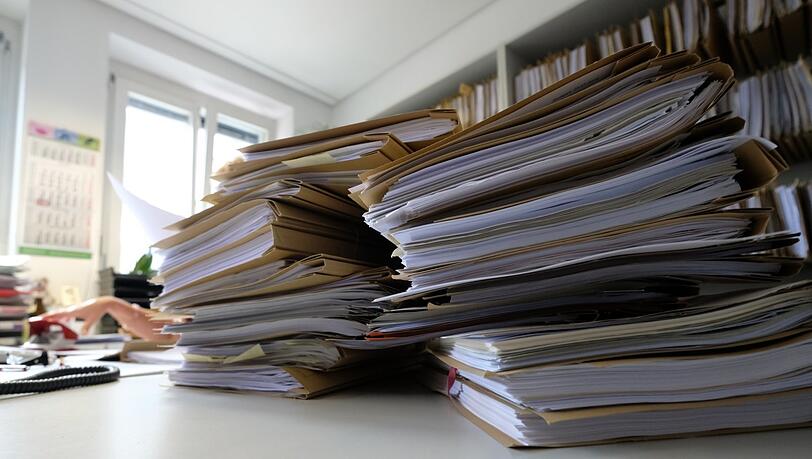Experten aus München verraten: So klappt der Bürokratieabbau in Deutschland
München - Wer beim Erstellen seiner Steuererklärung nicht mindestens einmal aus purer Verzweiflung vor dem Antrag kapitulieren wollte, lügt. Oder ist Steuerberater. Die Formularflut ist nicht nur für die Bürger im Privaten eine Last, sondern auch für die Unternehmen. Eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn zeigt, dass 92 Prozent der Unternehmen einen substanziellen Anstieg der Bürokratiebelastung über die letzten fünf Jahre hinweg wahrnahmen.
Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) sagt dazu der AZ: "Genauso wichtig wie der Abbau bestehender bürokratischer Hürden ist nach unserer Überzeugung die frühzeitige Eindämmung neuer Vorschriften und Belastungen." Die Wirtschaft ist sich einig: Es braucht weniger Bürokratie. Die Frage ist nur: wie? Um den Erfolg von Abbaumaßnahmen im Laufe der Jahre zu messen, führte die Bundesregierung 2012 den sogenannten Bürokratiekostenindex ein. Dieser ist zwar seitdem von 100 auf knapp 96 (September 2023) gefallen. Aber Wirtschaftswissenschaftler Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und Politikwissenschaftsprofessor Christoph Knill von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) halten diesen für nur begrenzt brauchbar.
Kampf gegen die Bürokratie: Die Ministerien müssten besser zusammenarbeiten, fordert Ökonom Röhl
"Die wahren Belastungen werden nicht vollständig abgebildet", sagt Röhl der AZ. Ein klarer Hinweis darauf sei auch die Menge an Klagen gegen Überbürokratie, die massiv zugenommen hätten. Verwaltungsforscher Knill stimmt zu: "Unsere Daten zeigen klar eine Regelzunahme über die letzten 50 Jahre. In allen Politikbereichen." Der Grund für diesen Anstieg: "Es ist häufig so, dass es Nachfrage aus der Gesellschaft nach Regeln gibt", sagt er der AZ. Die Wirtschaft sei hierfür ein gutes Beispiel: "Betriebe wollen etwa Schutz vor ausländischer Konkurrenz oder klare Investitionsregeln, damit keine Ungleichbehandlung stattfindet."
Die Rufe nach weniger Bürokratie aus der Wirtschaft müssen Knill zufolge differenziert werden: Einerseits sei es so, dass die Industrie versuche, die Debatte in ihrem eigenen Interesse zu nutzen, da sie nicht gerne reguliert werden möchte. Andererseits gebe es durchaus auch Regeln, wie etwa die zahlreichen Dokumentationspflichten, wo Unternehmen sehr stark belastet würden. Vor allem mittelständische, die nicht die Kapazitäten dafür hätten.
Ökonom Röhl nennt als Gründe für den Bürokratieberg schlechte Koordination der Ministerien und fehlenden politischen Willen. Das letzte Bürokratieentlastungsgesetz sei ein Paradebeispiel: "Es wurden von der Wirtschaft 450 Vorschläge eingereicht, aber es haben dann gerade einmal sechs in die Vorlage geschafft." Die Ministerien würden zu sehr darauf beharren, ihre Regeln zu behalten. Und verständigten sich dabei zu wenig mit den Kollegen. Das zeigt sich auch an Projekten wie dem Onlinezugangsgesetz, das 2017 verabschiedet wurde und alle Behörden dazu verpflichtete, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten – erfolglos. Die Länder hätte man mit der Umsetzung alleingelassen. Als Lösung für Bürokratieabbau hält Röhl daher eine bessere Zusammenarbeit der Ministerien und auch der Länder für unabdingbar. Und einen Kanzler, der sich des Themas annimmt.
Praxistests seien im Wirtschaftsministerium bereits erfolgreich, sagt Politikwissenschaftler Knill
Brossardt von der vbw fordert zugunsten des Abbaus der Bürokratie eine konsequente Einhaltung der "one in and two out"-Strategie: Das bedeutet, für jede neue Vorschrift müssen zwei alte gestrichen werden. Röhl ist von dieser Maßnahme hingegen nicht überzeugt: "Die Gefahr ist, dass nur Sachen gestrichen werden, die sowieso nicht mehr angewendet werden. Und dadurch geht die Wirkung gegen Null." Außerdem sei EU-Recht bislang ausgenommen. Auch Knill hält das für Augenwischerei: "Man weiß ja nicht, was man abschafft." Für eine bessere Verwaltung braucht es ihm zufolge auch erhöhte Umsetzungskapazitäten, etwa in Form von Personal.
Als Methode, um untaugliche Regeln zu identifizieren und infolgedessen abzuschaffen, hält Knill besonders die sogenannten Praxischecks für sinnvoll. Die unternimmt neuerdings das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne), um an konkreten Fallbeispielen zu testen, welche Regeln sich widersprechen. Das heißt: Es werden die einzuhaltenden Regeln, etwa für den Bau einer Windkraftanlage, auf Hemmnisse in der tatsächlichen Umsetzung geprüft. Solche Praxischecks erachtet Experte Knill auch für andere Ministerien als hilfreich. Und für effektiver als etwa den Normenkontrollrat oder die Beauftragten für Bürokratieabbau, um die Wurzel des Problems anzugehen: unsinnige, nur schwer zu verstehende Regeln aus der Welt schaffen.