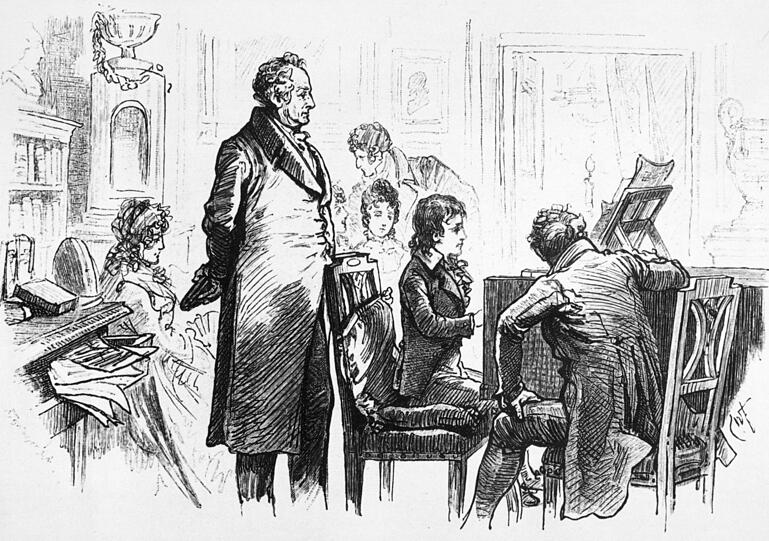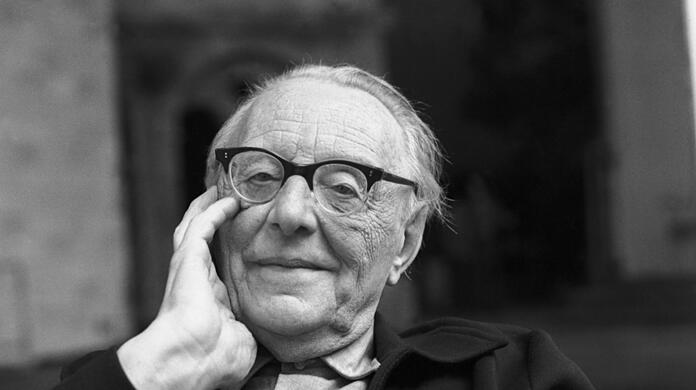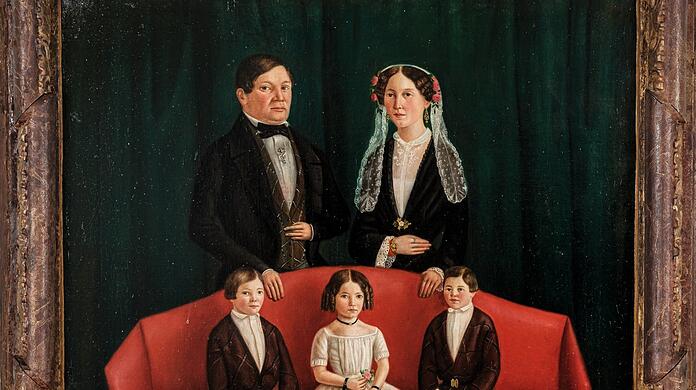Wie antisemitisch war Goethe?
Die Goethe-Ausgaben müssen nicht in den Giftschrank. Die Literaturgeschichte der Weimarer Klassik braucht auch nach W. Daniel Wilsons "Goethe und die Juden" nicht umgeschrieben werden. Aber das Buch fügt dem bisweilen allzu strahlenden Bild vom vorurteilsfreien Humanisten und Klassiker doch einige allzumenschliche Grautöne hinzu.
Einen Satz wie "Es wird eine Zeit geben, in der man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude und wer Christ sei: denn auch der Jude wird nach Europäischen Gesetzen leben, und zum Besten des Staats beitragen", hat Goethe nie geschrieben und schon gar nicht gesagt. Dieses Zitat seines älteren Zeitgenossen Johann Georg Herder zeigt aber, was im Weimar der Spätaufklärung denkmöglich war - wenn auch nur als Utopie, nicht als gesellschaftliche Realität.
Nie viel getaugt
Goethe hat sich in seinen veröffentlichten Werken mit Äußerungen zu Juden und jüdischen Themen zurückgehalten - teilweise offenbar aus taktischen Gründen, wohl wissend, dass seine Position teilweise schon damals für eine intellektuelle Elite anstößig war. Die entsprechenden Passagen dürften auf zehn Druckseiten seines sehr umfangreichen Gesamtwerks passen. Wilson hat darüber hinaus, die Quellenproblematik stets mitbedenkend, überlieferte Gespräche mit Goethe und Dokumente seiner Tätigkeit als Staatsmann und Theaterleiter einbezogen.

Die schärfste antisemitische Äußerung steht wohl in der ältesten Fassung des Romans "Wilhelm Meisters Wanderjahre". Dort heißt es: "Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt." Es überliste "durch seine bewegliche Tätigkeit die Ruhenden". Daher sei es vom Bund der Auswanderer dieses Romans ausgeschlossen.
Das trifft den Kern von Goethes Ressentiment, das - so auch in "Faust II" - immer wieder geradezu obsessiv auf Geldgeschäfte und angebliche Übervorteilung zurückkommt, ohne dabei die Diskriminierung der Juden mitzudenken, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit auf Geldgeschäfte und den Gebrauchtwarenhandel beschränkte. Darüber hinaus scheint der Dichter immer wieder an der jüdischen Sprechweise ästhetischen Anstoß genommen zu haben.
Erste Kontakte zu Juden hatte Goethe als Jugendlicher durch Besuche im Frankfurter Ghetto, die er rückblickend in einer stark stilisierten Passage seiner Autobiografie "Dichtung und Wahrheit" beschreibt. Bei einem Brand in der Judengasse soll er beim Löschen geholfen haben. Als das Ghetto 1796 nach der Beschießung der Stadt durch französische Truppen größtenteils abbrannte, zogen die Bewohner zum Missfallen des Rats in andere Stadtteile.

Goethe verfolgte die breite publizistische Debatte über die Auflösung des Ghettos und stand den Forderungen nach der gesetzlichen Gleichstellung der Bewohner eher skeptisch gegenüber. Diese Haltung war konservativ, und in vielem erinnern die von Wilson nachgezeichneten Debatten an heutige Diskussionen über Zuwanderung und Integration.
Ungerechter Wegezoll
Frankreich war zu diesem Zeitpunkt bereits weiter. 1791 hatte die Nationalversammlung als Konsequenz der Erklärung allgemeiner Menschen- und Bürgerrechte die Gleichstellung aller französischen Juden garantiert. Entsprechende Regeln galten im Gefolge der Napoleonischen Kriege ein Jahrzehnt später auch in den unter französischem Einfluss stehenden rechtsheinischen Gebieten wie dem Königreich Westphalen. Andere deutsche Länder zögerten die rechtliche Gleichstellung bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus.
Auch der Großherzog von Sachsen-Weimar war ein Anhänger der Judenemanzipation. Er wurde von seiner Verwaltung allerdings ausgebremst. Denn das Land verdiente am "Geleit", einem vormodernen Wegezoll, den reisende jüdische Händler zunehmend als diskriminierend empfanden, was zu Konflikten führte, mit denen Goethe als Mitglied des Geheimen Consiliums befasst war. In Weimar selbst lebten nur wenige Juden, wie der von Goethe in einem Gedicht erwähnte Hoffaktor Jacob Elkan, der wohl mit Altwaren handelte und von dem sich Goethe offenbar übervorteilt fühlte.
Wie andere Zeitgenossen fürchtete Goethe wohl eine Überfremdung durch zuwandernde Juden. Die religiöse Selbstverwaltung der jüdischen Gemeinden scheint ihm wie die Freimaurerei als Staat im Staat politisch suspekt gewesen zu sein. Besonders abfällig äußerte er sich offenbar zum Aufstieg von Juden durch sogenannte "Mischehen" in höchste gesellschaftliche Kreise.

Von einem rassistischen Antisemiten im späteren Sinn unterschied sich seine Haltung gegenüber christlich erzogenen und getauften Juden wie Felix Mendelssohn Bartholdy und diversen Damen, mit denen er in Karlsbad verkehrte. Die wiederum waren bei der Verbreitung seiner Werke hilfreich, und Goethe scheint in diesem Punkt bereit gewesen zu sein, seine Vorbehalte hintanzustellen.
Wilson unterscheidet bereits im ersten Kapitel genau zwischen historischen und modernen Formen der Judenfeindschaft. Auch wenn sich das nüchtern argumentierende Buch bisweilen im Detail verliert, bleibt es auch für literaturwissenschaftliche und historische Laien gut lesbar. Wenn man dem Autor glauben darf, scheint sein Buch die erste umfangreichere Darstellung zu diesem Thema zu sein. Angesichts dessen ist man als Leser geneigt, dem Fazit des Autors zuzustimmen: "Kann nicht endlich ein Anfang gemacht werden, Goethes Sparren im Kopf in Judensachen zu sehen und offen zu diskutieren?"
W. Daniel Wilson: "Goethe und die Juden. Faszination und Feindschaft" (C. H. Beck, 351 S., 29.90 Euro)
- Themen: