"Ein absolut furchtloser Denker" - Lutz-W. Wolff übersetzt George Orwell neu
Der Britische Schriftsteller Eric Arthur Blair, der unter seinem Pseudonym George Orwell Weltruhm erlangte, starb im Januar 1950 im Alter von nur 46 Jahren an einem Lungenleiden. Ein halbes Jahr zuvor war sein Roman "1984" erschienen. Da nun die Rechte frei sind gibt es gleich mehrere Neuübersetzungen von Orwells Klassikern. Lutz-W. Wolff hat für den Münchner dtv-Verlag "1984" und "Animal Farm" neu übersetzt.
AZ: Herr Wolff, was macht Orwells totalitäre Schreckensvision "1984" seit Jahrzehnten aktuell?
LUTZ-W. WOLFF: Es gibt keine politische Fraktion, kein Lager, das ihn für sich allein beanspruchen könnte. Robert Habeck hat ein Vorwort zu meiner Übersetzung geschrieben, in dem er sich auf Trump und die AfD stürzt, aber das ist nicht die alleingültige Sicht. Ich denke, "1984" ist ein Klassiker der von den verschiedensten Seiten interpretiert werden kann. Der Roman ist ein Vexierbild, man muss bei der Interpretation sehr vorsichtig sein, er hat mehrere doppelte Böden. Trotzdem - oder gerade deshalb - ist er hochaktuell. Wenn man begreifen will, was politisch in Amerika, aber auch in Deutschland gerade geschieht, muss man "1984" noch einmal neu und gründlich lesen.
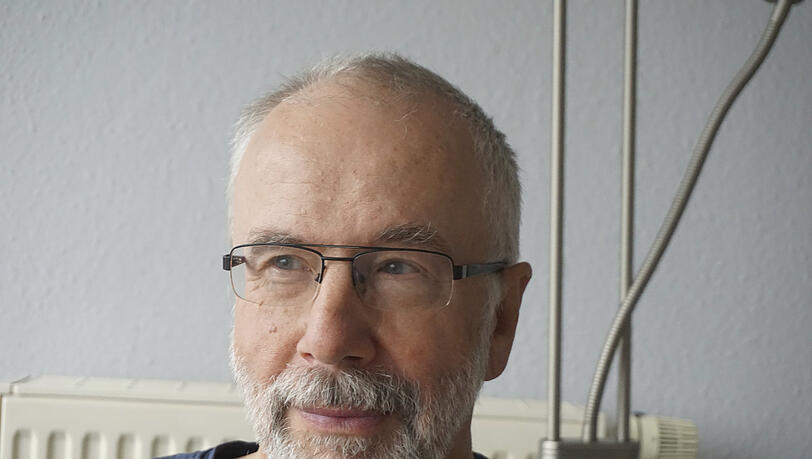
Letzte Woche hat sich Donald Trump jr auf Orwell berufen, weil sein Vater von Twitter mit einer Sperre belegt wurde.
Diese Sperre hat auch die Kanzlerin negativ kommentiert.
Orwell hätte Trump nicht bei Twitter gesperrt, obwohl er dort lauter Lügen verbreitet?
Orwell hat Zensur erlebt, sein Buch "Animal Farm", eine satirische Abrechnung mit Stalins Verrat an den Idealen der russischen Revolution, wurde von britischen Verlagen abgelehnt, weil die Verleger Stalin nicht verärgern wollten. Er war ja schließlich Verbündeter im gemeinsamen Kampf gegen Hitler. Aber Orwell stand immer auf der Seite der Freiheit nicht der Zensur. Er war ein absolut furchtloser Denker. Er hätte sich nie an irgendwelchen Leisetretereien beteiligt, wie sie heute im öffentlichen Diskurs verlangt werden.
Gibt es denn die Freiheit zu lügen?
Na ja, mit dem Lügen ist das so eine Sache. Dem einen seine Lüge ist dem anderen seine Wahrheit. Das Nebeneinanderstehen von verschiedenen Ansichten muss möglich sein. Am Eingang der BBC stehen heute ein Orwell-Denkmal und sein berühmter Satz: "Freiheit ist das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen." Es ist nett, dass die BBC sich so auf Orwell beruft, nachdem er dort im November 1943 recht unzufrieden ausgeschieden ist. Ich habe - wie Orwell - auch bei der BBC gearbeitet, Mitte der 70er Jahre, beim Deutschen Dienst. Der Auslandsdienst der BBC wurde damals wie heute vom Foreign Office, dem britischen Außenministerium, finanziert. Deswegen war es immer Propaganda, was dort gemacht wurde. Das Erlebnis der gesteuerten, der geprägten Nachrichten hatte ich auch. Orwell hat die Notwendigkeit von Propaganda übrigens vollkommen eingesehen.
Wann haben Sie "1984" zum ersten Mal gelesen?
Ich muss so um die fünfzehn Jahre alt gewesen sein.
Und die beklemmende Atmosphäre des Romans hat sie erschüttert?
Nö, ich hab mich mehr für den Sex interessiert - wie wohl jeder Junge in diesem Alter.
Als erotischerAutor ist mir Orwell bislang nie aufgefallen.
Selbstverständlich nicht, aber Orwell hatte schon begriffen, dass Sexualität eine freiheitliche Kraft ist, die sich gegen jede autoritäre und zensierende Gewalt wehren kann. Er hatte dabei natürlich die katholische Kirche als seinen Widersacher im Blick. Orwell hat in den 30er Jahren Henry Miller und James Joyce propagiert und deren Bücher nach England geschmuggelt. Er ist von der Polizei verhört worden, weil er "Pornografie" ins Land gebracht hatte, sie haben sogar einmal sein Haus durchsucht. Als er Ende 1936 in den Spanischen Bürgerkrieg zog, hat er Henry Miller in Paris besucht und die beiden haben sich über die wahre Freiheit gestritten. Am Ende hat ihm Miller eine alte Jacke geschenkt.
Orwell hat in einem Essay von der "moralischen Verpflichtung" gesprochen, gut zu schreiben. Was bedeutet das?
Seine Sprache klingt auch heute noch modern, weil er klar und einfach geschrieben und alle Manierismen vermieden hat. Es ist ein sehr strenger Stil, er versucht eine ehrliche, saubere Sprache zu verwenden. Man muss vielleicht auch sehen, dass Orwell nicht studiert hat, er war kein klassischer Intellektueller sondern ein ausgebildeter Polizist. Geschrieben hat er über Erfahrungen die er reell gemacht und gesucht hat. Er hat sich beispielsweise über Weihnachten ins Gefängnis sperren lassen, um zu wissen, wie es dort zugeht. Er schildert in "Down and out in Paris and London" das Leben von Landstreichern und Tagelöhnern, indem er selbst so gelebt hat: eine Art Wallraff-Journalismus schon damals.
Er hatte aber doch die Möglichkeit, das Experiment jederzeit abzubrechen?
Nicht wirklich, er war sehr arm bis zu dem unerwarteten Erfolg mit "Animal Farm" im Jahr 1945 - den hatte er auch dringend nötig. Der Roman war unter anderem deshalb so schnell erfolgreich, weil er sich hervorragend für den Kalten Krieg eignete und von der CIA verbreitet wurde.
Ein Teil von Orwells Erfolg ist sicher auch in seiner Person begründet - er war eine moralische Instanz, ein unkorrumpierbarer Künstler.
Dass er für seine Ideale im Spanischen Bürgerkrieg sein Leben riskiert hat, hat ihm natürlich Renommee gebracht. Er war überhaupt kein Selbstdarsteller, aber er war ein sehr kantiger Typ. Gegen moralische Figuren wie Tolstoi und Gandhi hatte er durchaus etwas. Er war beispielsweise der Meinung, dass man für die richtige Sache auch Gewalt anwenden müsse, sonst wäre er ja auch nicht nach Spanien gegangen, wo er dann auf Seiten der Anarchisten gekämpft hat. Es gab allerdings eine Wende in seinem Leben, als er als Polizist in Birma einen Elefanten erschoss, der einen Kuli tödlich verletzt hatte. Das war ein traumatisches Erlebnis für Orwell, das er später in der Geschichte "Shooting an Elephant" verarbeitet hat.
"1984" spielt in England, Orwell will damit sagen: Totalitäre Systeme sind überall möglich.
Ja, Orwell hat den modernen, repressiven Überwachungsstaat vorausgesehen. Er beschreibt die Methoden der Bewusstseinsindustrie - um einen Begriff von Enzensberger einzubringen - die in den westlichen Demokratien dazu dient, die Menschenmassen zu beherrschen. Interessanterweise finden die meisten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, die heute in Deutschland und Europa überall stattfinden, größtenteils mit der Zustimmung der Bevölkerung statt. Die Kameras im öffentlichen Raum, die bei Orwell noch als großer Schrecken dargestellt werden, sind heute gewünscht von den Menschen. Die Beobachtung durch die Teleschirme in Orwells Buch könnte man auch mit einem Smart-TV oder Alexa durchführen. Die Überwachung wird jedes Jahr mehr, die persönliche Freiheit immer kleiner. Als "1984" geschrieben wurde, gab es zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, heute sind es fast acht Milliarden, dreimal so viel. Je mehr Menschen es auf der Welt gibt, je heterogener die Bevölkerungen sind, desto kleiner werden die Freiräume. Das ist fast ein Naturgesetz.
Orwell hofft auf die mündigen Bürger und wachen Mitmenschen, um den totalitären Staat zu verhindern - interessanterweise gibt es keine Gesetze in seinem Staat. Dafür weiß jeder, dass das Führen eines persönlichen Tagebuchs schon ein Todesurteil bedeutet.
Das ist eine brillante Analyse des totalitären Systems: Es geht nicht um Recht und Gesetz, sondern um die Kontrolle des Denkens. Es geht nicht mal unbedingt um das Todesurteil durch ein Erschießungskommando, sondern um den sozialen Tod, der eintritt, weil immer mehr Angst vor der "Abweichung" von der Norm herrscht. Das führt zu immer engeren Meinungskorridoren - und das kann man auch in der heutigen Gesellschaft sehr gut beobachten. Die Speerspitze von Orwells Denken findet sich deshalb in seiner Beschreibung von NeuSprech.
In "1984" ist die Bezeichnung für ein Zwangsarbeiterlager "JoyCamp", bei uns wurde die "Rückführungspatenschaft" als Bezeichnung für eine Zwangsabschiebung "Unwort des Jahres".
Das sind politische Euphemismen, wie sie schon im Dritten Reich sehr stark entwickelt wurden. Für mich beginnt NeuSprech aber schon bei sprachlichen Verrücktheiten wie Gendersternchen, die uns momentan aufgedrückt werden. Die sind ja bis in die öffentlich-rechtlichen Medien vorgedrungen - und das finde ich unglaublich. Political Correctness ist übrigens genau das, wogegen Orwell angeschrieben hat.
In Ihrer Übersetzung steht "Big Brother is watching you" und nicht "Der große Bruder wacht über Dich".
Man muss sehen, dass wir dem Englischen in den letzten sieben Jahrzehnten sehr viel näher gerückt sind. Manche Slogans - und ganz speziell dieser - ist ja auch bei uns im englischen Original bekannter als in der deutschen Übersetzung. Ich habe auch bei "Animal Farm" die englischen Namen der Tiere belassen, obwohl die früheren deutschen Übersetzungen zum Teil sehr lustig und fantasievoll waren.
"Animal Farm" ist trotz der düsteren Geschichte über den Verrat der Schweine an den anderen Tieren ein Buch mit sehr lustigen Stellen, angeblich auch ein Verdienst von Orwells erster Frau Eileen.
Ich kann mir das gut vorstellen, Orwell hat ihr jeden Satz vorgelesen und sie hatte großen Einfluss auf das Buch. Tragischerweise starb sie ja kurze Zeit später - und Orwell fiel in ein schwarzes Loch. Er hat dann fast verzweifelt eine neue Frau gesucht, schon als Mutter für seinen Adoptivsohn.
Einer Frau schrieb er: "Möchten Sie die Witwe eines Schriftstellers werden?" Er kokettierte mit seinem neu erworbenen Geld und seinem fürchterlichen Gesundheitszustand.
Er war Frauen gegenüber völlig hilflos. Sonia Brownell, die einmal eine kurze Affäre mit ihm gehabt hatte, hat ihn dann schließlich auf dem Sterbebett geheiratet. Auf Rat seines Verlegers wurde sie seine letzte Ehefrau - und Erbin.
Wenn Sie noch ein Buch von Orwell übersetzen dürften, welches würden Sie dann wählen?
Als Romancier hat er eigentlich erst mit "Animal Farm" eine Sprache gefunden. Vorher hat er in seinen Romanen - wie viele andere - versucht, Literatur zu machen, was immer eine Katastrophe ist. Seine Essays haben allerdings eine andere Qualität und einige von ihnen sollten unbedingt in einer Sammlung neu vorgestellt werden.
George Orwell: "1984" (dtv, 416 Seiten, 24 Euro, Vorwort von Robert Habeck), "Animal Farm" (dtv, 192 Seiten, 20 Euro)








