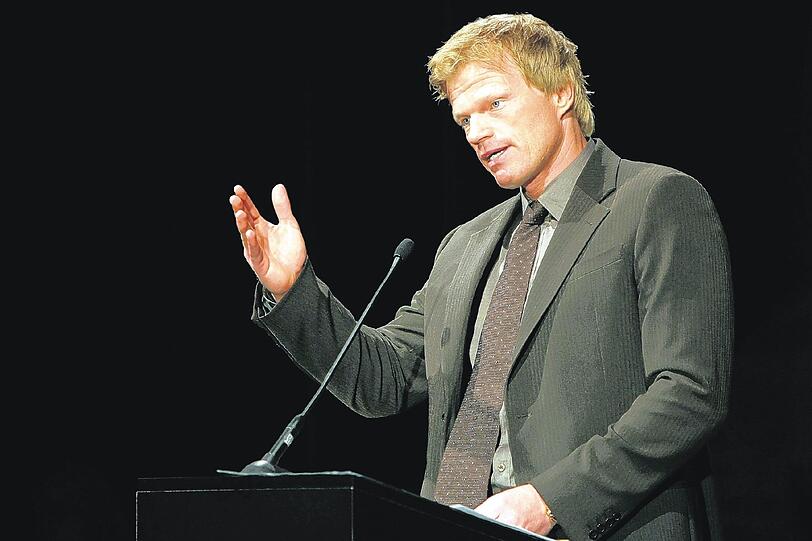Von der Hand in den Kopf und wieder zurück
MÜNCHEN - Zwischen Unterbewusstsein und Unterhose, zwischen Walt Disney und Gregor Gysi: Die Autobiographien der Sportidole Oliver Kahn und Stefan Kretzschmar im Vergleich
Das erste Wort, bei beiden gleich. „Ich“. Was sonst. Darum geht es ja in Autobiographien vor allem, aber erst recht dann, bei Ego-Typen wie Oliver Kahn und Stefan Kretzschmar. Zwei Sportler von Weltformat, die beide vor allem auf ihre Hände angewiesen waren. Zwei polarisierende Selbstdarsteller, beide zweifache Familienväter, die in den Klatschmagazinen und Promi-Kolumnen waren, beide wegen ihrer neuen Partnerinnen.
Und sonst, Gemeinsamkeiten bei beiden? Sie, die nach der Karriere, in der sie vor allem auf ihre Hände angewiesen waren, ihre Gedanken wieder zu Papier brachten. Von der Hand in den Kopf und wieder zurück. Ein Vergleich der Autobiographien. „Ich“ von Kahn, dem Fußball-Torwart aus dem Südwesten des Landes, und „Anders als erwartet“ von Kretzschmar, dem Handballspieler aus dem Nordosten.
KINDHEIT
Bei Kahn geht es um ihn als achtjährigen Pimpf, der jede Woche zur Verlosung einer Kamera ins Kaufhaus rannte, bis nach vielen Monaten endlich sein Name aus der Lostrommel gezogen wurde. Kahn beschreibt seine „einfache, irre, glückliche Freude“. Erst viele Jahre später hätte er gesagt: „Da ist das Ding.“
Andere Dinge sieht der kleine Stefan mit neun. Nämlich seine Eltern beim Koitus. Sie dabei zu erwischen, schreibt er, „ist noch schlimmer als sich seine Eltern beim Sex vorzustellen.“ Eine Seite weiter schreibt er über Schamhaarrasur. Intimbereiche, die Kahn meidet. Er schreibt nur über das Innere des Unterbewusstseins. Nicht das Innere der Unterhose.
FRAUEN
Bei Kretzschmar im Detail. Die Rückkehr zu seiner Ex Maria, dazwischen die vier Jahre mit Franzi van Almsick, die noch halbwegs oberflächlich bleiben. Bis zurück zu seinem ersten Mal. Mit 15. Wo er seine Liegestützen beim Beischlaf mitzählte. Am Ende kam er auf 51.
Liegestützen machte Kahn höchstens in der Kraftkammer, und wenn woanders, dann steht das nicht in seinem Buch. Nix Simone, nix Verena, keine Affären und Frauengeschichten. Nur auf Seite 91 bezeichnet er Sex als „biologisches Grundbedürfnis“. Allerhand.
VORBILDER
Bei Kahn eine bunte Palette. Björn Borg, John McEnroe, Tiger Woods. Er schreibt über Politiker wie Franklin D. Roosevelt, Philosophen wie Immanuel Kant, Schriftsteller wie Paolo Coelho. Dazu gibt es immer wieder kluge Leitsätze berühmter Menschen: Walt Disney, Bill Cosby, Albert Einstein. Manchmal hat man dabei aber das Gefühl, er hat sich die Sinnsprüche aus einem Zitate-Duden abgeschrieben, weil sie halt gut klingen.
Kretzsche lässt über sich schreiben. Ein Einwurf am Ende eines Kapitels. Heiner Brand, Dirk Nowitzki, Gregor Gysi. In unterschiedlicher Qualität. Gysis spannendster Satz lautet: „Er hat etwas Rebellisches, etwas Aufsässiges an sich.“ Ach wirklich?
Lustiger liest sich Kumpel Campino. Über ein Handballspiel seiner Toten Hosen gegen die Nationalmannschaft („Für uns kein ruhmreicher Tag“) bis hin zu einer SMS, die er 2000 aus Sydney erhielt: „Schatzi, habe großen Mist gebaut und mich verliebt.“ Und zwar in die Franzi. Dazu passt aus dem Kahn-Buch der Spruch: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ Nur gab es bei Franzi und Kretzsche für den Traum halt kein Happy End. Anders als bei Disney.
MISSION
Ganz wichtig. Beide stellen sich so dar, wie sie es gerne hätten. Kahn schreibt über die Momente, die eh die ganze Welt kennt. Seine Paraden in vielen Elferschießen, die 99er-Pleite im Finale gegen Manchester, seine Umarmung für Jens Lehmann im WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Damit jeder sieht: Mensch, der Olli, toller Typ.
Als wilder Typ kommt Kretzschmar rüber, und auch wenn sein Buchtitel anders lautet, das meiste ist doch erwartbar. Beide bedienen die Klischees. Kahn, Ehrgeizling und Sportsmann, Kretzsche, der unkonventionelle Rebell, der Joints raucht.
LESESPASS
Überschaubar, zumindest bei Kahn. Viel zu langatmig und wirr. Auf 350 Seiten permanent über Ziele und Motivation, das Scheitern, die Erfolge und die Perfektion zu lesen, nervt. Dazu schauderhafte Anglizismen wie die „Step-Motivation“, die „Lose-Win-Situation“, der „Power Cube“ oder das „Power Thinking“, auf Dauer extreme boring. Also wahnsinnig fad.
Als Kahn schreibt, dass immer alles richtig ist, was er macht, steht gleich in Klammern dahinter, dass das ein Scherz sei. Obacht, Witz.
Zum Lachen ist auch bei Kretzschmar wenig, immerhin erfährt der Leser etwas über das schwierige Verhältnis zur Mama, die Jugend in der DDR, Erfahrungen mit Drogen und mit dem Tod. Ist dann doch spannender.
FAZIT
Würde man beide nach Lektüre ins Fernsehen stecken wollen, wäre Kahn am ehesten noch ein mitteilsamer Managertrainer, der als Psycho-Onkel bei Anne Will erklärt, dass die Menschheit gerettet ist, wenn sie nur sein Buch befolgt. Ganz ohne Scherz.
Und Kretzschmar wäre gut bei Big Brother im Container aufgehoben, weil, boah ey, da geht es auch recht krass und vulgär zu. Zwei Bücher zwischen Erfolgen und Exzessen. Zwischen Niederlagen und Flachlegen. Wo der eine über Körpersprache schreibt. Und der andere über Körpersäfte.
Florian Kinast