Politologe: "Europa kann Trump dankbar sein"
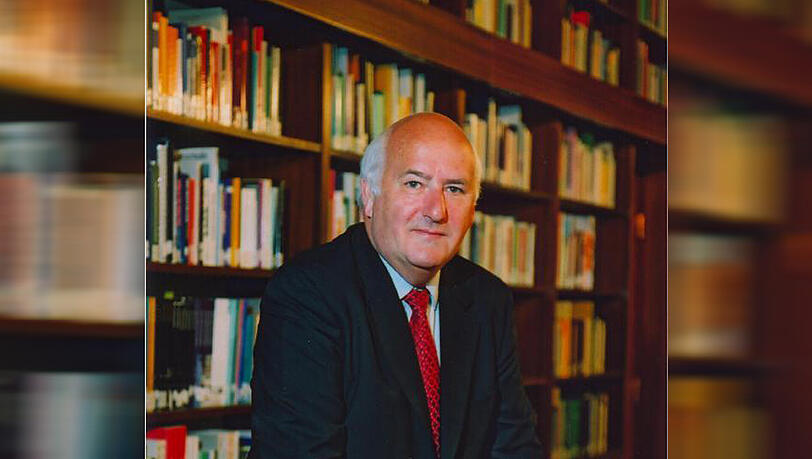
München - Die AZ bat den Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld, Professor mit Lehrstuhl für Politische Systeme und Europäische Einigung an der LMU und Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung, um eine Einschätzung zu dem Thema.
AZ: Herr Professor Weidenfeld, Bundeskanzlerin Angela Merkel meint, Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wie könnte das konkret aussehen?
WERNER WEIDENFELD: Europa muss handlungsfähiger werden und seine strategische Kultur pflegen. Dass die Bundeskanzlerin das jetzt gesagt hat, ist absolut vernünftig – und liegt auf der Hand. Man kann sagen, Europa kann Trump dankbar sein, dass er es zu dieser Erkenntnis gebracht hat. Das hätte es schon sehr viel früher umsetzen müssen. Denn Europa ist ein weltpolitischer Faktor und man kann nicht sagen, wenn wir ein Problem haben, werden die Amerikaner das schon regeln. Das konnte man schon vor Trump nicht.
Was ändert sich im Vergleich zu damals?
Damals waren die Amerikaner kooperativer und freundlicher. Aber jetzt kann man davon ausgehen, dass Amerika so oder so unkalkulierbarer wird. Es kann durchaus sein, dass Amerika sagt: Ja, da müssen wir den Europäern beistehen, die haben Probleme. Oder aber gerade das Gegenteil. Das ist unkalkulierbar geworden und deshalb muss Europa aus eigenem Interesse seine Handlungsfähigkeit forcieren.
Welche Möglichkeiten hat Europa, entscheidungsfähiger zu werden?
Zunächst hat es einen ökonomischen Spitzenraum in der Welt: die EU. Den kann es entsprechend für Interessenlagen ins Spiel bringen. Jetzt muss die EU eine Außen- und Sicherheitspolitik entfalten, für welche die Instrumente im Kern ja vorliegen. Und die dann unterfüttern mit einer strategischen Kultur. Das Hauptdefizit Europas heute, man kann fast sagen, der Politik generell im europäischen Raum, ist das strategische Defizit. Und darunter leiden viele Menschen.
Was ist das "strategische Defizit"?
Die Menschen wollen die Lage erklärt bekommen. Sie wollen wissen: Worauf steuern wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu? Da gibt es aber keine Antwort. Das ist zu korrigieren. Und unter diesem Druck, unter dem Europa jetzt steht, bin ich auch zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren passiert.
Sie sprechen von den "Instrumenten" der Europäer. Was meinen Sie damit?
Sie haben die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die hohe Repräsentantin, Frau Mogherini. Sie haben Tausende von Mitarbeitern im diplomatischen Dienst, die politische Kooperation. Es wurde jetzt beschlossen, eine Art militärisches Hauptquartier zu schaffen. Und sie haben Frontex, das gewissermaßen die Außengrenzen mitorganisiert. Sie haben eine lange Liste von Instrumenten, die man jetzt strategisch bündeln und orientieren muss.
Europa ist also nicht auf die USA angewiesen?
Nein. Es ist hilfreich, wenn man gute, starke Partner hat. Aber wenn Amerika nicht will, dann kann man auch intensivere Partnerschaften mit Brasilien, China, Indien aufbauen, und entsprechend weltpolitisch Verantwortung übernehmen.
Sicherheitskonferenz-Chef Ischinger sagte, man dürfe die Nabelschnur zu den USA nicht völlig kappen.
Das wäre ja auch dumm. Wir haben sie ja auch nicht mit der Türkei gekappt, als es unfreundlich wurde und mit vielen anderen Partnern auch nicht. Weil man ein Interesse daran hat, die Chancen offen zu halten und kooperieren zu können.
Lesen Sie auch: Merkel und Schulz für ein stärkeres Europa
Lesen Sie auch: AZ-Kommentar - Neuorientierung Europas? Kurs auf Fernost!

