Klima-Sondervermögen: Verschleudert die Groko 100 Milliarden Euro?
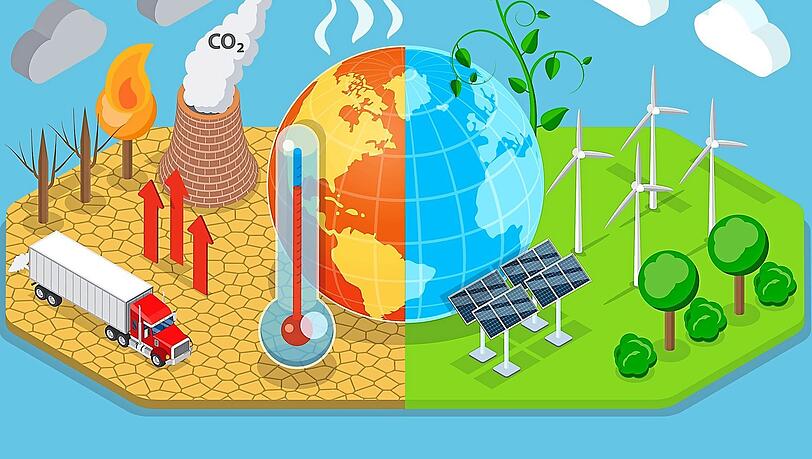
Damit die Groko die 500 Milliarden Euro schwere Neuverschuldung für Infrastruktur im Grundgesetz verewigen durfte, haben die Grünen ihnen ein Fünftel davon fürs Klima abgeknöpft. Das Klima-Sondervermögen war geboren – auf zwölf Jahre gestreckt sind das jährlich rund acht Milliarden Euro extra für grüne Investitionen.
Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union darauf geeinigt, den Klima- und Transformations-Fonds (KTF) jährlich mit zehn Milliarden Euro aus dem Sondervermögen aufzumöbeln.
Schwarz-Rot will elektrische Bahn und günstigeren Strom
Die hat der KTF angesichts der klaffenden Finanzierungslücke auch dringend nötig: Denn für 2025 sind Einnahmen von 15,4 Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung, 6,7 Milliarden Euro durch die Versteigerung von Emissionszertifikaten und 316 Millionen Euro aus den Rücklagen eingeplant (22,5 Milliarden Euro insgesamt).
Dem gegenüber stehen 34,5 Milliarden Euro an Ausgaben – ohne die neuen Projekte der Bundesregierung miteinzurechnen.
Bisher finanziert der KTF etwa klimafreundliche Heizungen und Sanierungen, E-Ladesäulen und -Busse sowie Zuschüsse für stromintensive Unternehmen als Ausgleich für die durch den Emissionshandel bedingten Strompreiserhöhungen.

Schwarz-Rot plant mit dem KTF, in die Digitalisierung und die Elektrifizierung des deutschen Schienenbetriebs zu investieren und beim Strompreis zu entlasten.
Karen Pittel, Wirtschaftsprofessorin für Klima beim Münchner ifo-Institut, sieht das kritisch. Zur Bahn-Investition sagt sie der AZ: "Ich sehe das als etwas, was ich nicht über den KTF finanzieren würde, weil es eine Infrastrukturmaßnahme ist, die unabhängig vom Klimaschutz getätigt werden sollte." Die Bahn braucht bis 2034 bis zu 150 Milliarden Euro an Investitionen. Den KTF dafür einzuspannen, könnte laut Pittel den Fonds schnell auffressen.
Sondervermögen könnte ausgehöhlt werden
Auch die Kompensation für die gesenkte Stromsteuer aus dem KTF zu finanzieren, hält sie für falsch - das Geld wäre besser investiert in Infrastrukturprojekten.
Denn: "Sinnvoll wäre es, so zu investieren, dass es langfristig Wirtschaft und Gesellschaft etwas bringt", sagt Pittel. Auch die Grünen befürchten, dass der Großteil der zusätzlichen Mittel im KTF auf die Strompreissenkungen entfallen werde. "Gleichzeitig will die Bundesregierung neue Gaskraftwerke fördern, die diese Kosten wieder in die Höhe treiben", sagt Lisa Badum (Grüne), Obfrau im Bundes-Klimaschutzausschuss, der AZ.
Die Folge: Die geplanten Projekte könnten das Sondervermögen schrittweise aushöhlen. Diese Befürchtung äußert zumindest das Wirtschaftsinstitut Dezernat Zukunft – geleitet von der Münchner SPD-Direktkandidatin bei der vergangenen Bundestagswahl – auf Nachfrage der AZ.
Investitionen in Strom- und Wasserstoffnetze sollten priorisiert werden
Wenn sich Schwarz-Rot in ihren Plänen für das Sondervermögen verrennen, was müsste stattdessen gefördert werden?
Zeitlich dringend sind laut Pittel vom ifo-Institut Fortschritte bei einer ganzen Reihe an Infrastrukturmaßnahmen wie Strom- und Wasserstoffnetzen, aber auch der stärkere Ausbau der Ladeinfrastruktur und Wärmenetze.
Zur Anpassung an den Klimawandel wären Investments etwa in Flutbarrieren und in den grün-blauen Umbau von Städten wichtig, um bei Hitze abzukühlen und bei Starkregen das Wasser abfließen zu lassen.
Pittel warnt jedoch davor, sich allein auf staatliche Investments zu verlassen. "Der Staat kann nicht alles, was nötig ist, allein finanzieren. Er sollte versuchen, die Schuldenaufnahme möglichst gering zu halten."
Sie schlägt daher private Co-Finanzierung vor: "So lässt sich nicht nur das Risiko bei Privaten reduzieren, sondern auch die Finanzierungslast des Staates." Die Gefahr bestehe allerdings, dass sich private Investoren angesichts der fast unbegrenzt möglich erscheinenden Schuldenaufnahme des Staates zurückhalten.
Bis 2045: Öffentliche Sektor muss 37 bis 52 Milliarden Euro mehr investieren
Klar ist aber auch: "Ich glaube nicht, dass man mit 100 Milliarden Euro Investitionen im Bereich des Klimaschutzes langfristig davonkommen wird."
Das zeigen die Studien, die der Expertenrat für Klimafragen in seinem Zweijahresgutachten ausgewertet hat: Allein der öffentliche Sektor müsste bis 2045 jährlich 37 bis 52 Milliarden Euro mehr investieren – entweder direkt oder zur "Schaffung von Investitionsanreizen" für Privatakteure.
Zehn Milliarden Euro jährlich für KTF: "Das ist viel zu wenig"
Warum ausgerechnet nur zehn Milliarden Euro jährlich in den KTF fließen sollen, wollten SPD und Union auf Nachfrage der AZ nicht beantworten.
Grünen-Politikerin Badum ist sich jedenfalls sicher: "Das ist viel zu wenig, um den zahlreichen Zukunftsaufgaben im Bereich Klimaschutz gerecht zu werden."
Die Protestbewegung Fridays for Future fordert deshalb für den Klimaschutz nicht nur 100 Milliarden Euro insgesamt, sondern pro Jahr. Ohne Reform der Schuldenbremse ist das jedoch nur schwer vorstellbar.
Ökonomin Pittel sagt dazu: "Man sollte nicht nur über neue Schulden nachdenken." Es solle ein Gesamtpaket geschnürt werden, das auch höhere Steuereinnahmen umfassen könne oder Ausgaben zurückfahre – etwa durch eine gezielte Förderung beim Kauf neuer Heizungen für jene, die es sonst nicht könnten, statt der Gießkanne für alle.

