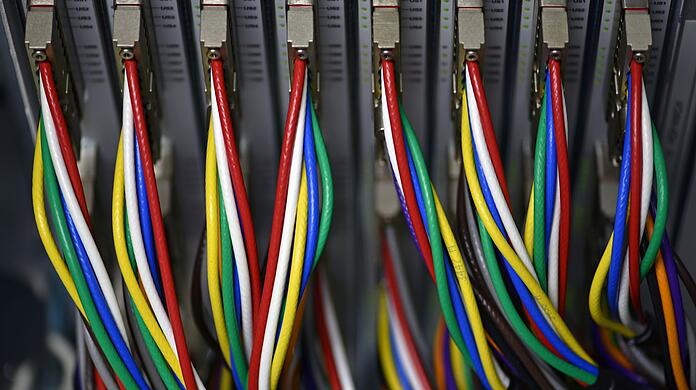Theologieprofessor Wolfgang Huber: "Abschied von der Realität"
München - AZ-Interview mit Wolfgang Huber: Der 79-jährige Theologe war von 2003 bis 2009 Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Mitglied des Deutschen Ethikrats wirkte er von 2010 bis 2014.
Eine "Ethik der Digitalisierung" strebt Wolfgang Huber, einst Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, an. In seinem Buch "Menschen, Götter und Maschinen" schreibt er über Gefahren, die in der immer weiter fortschreitenden Technik liegen, aber auch über Hoffnung und Möglichkeiten.
AZ: Herr Professor Huber, Sie schreiben von einer Zeitenwende, was die Digitalisierung betrifft. Sind sich die Menschen dessen bewusst?
WOLFGANG HUBER: Ich glaube, dass die Digitalisierung ähnlich umstürzend ist wie die Erfindung des Buchdrucks. Aber ich glaube nicht, dass alle Menschen darüber so grundsätzlich reflektieren. Dennoch ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen - weil der Umgang mit dieser Technologie nicht nur eine Frage ist, die mit eigenen technischen Fertigkeiten zu tun hat, sondern auch eine Frage der grundsätzlichen ethischen Überlegung, was man sich selbst und anderen zumuten möchte.
Gleichzeitig wird eine Sehnsucht nach Verlangsamung beschrieben - beobachten Sie das auch?
Es gibt diese Sehnsucht. Ich bin fest davon überzeugt, dass angesichts der vollkommen anderen Rhythmen des täglichen Lebens, die sich durch die Digitalisierung einspielen, Menschen bewusst Gegengewichte setzen müssen. Man braucht Zeiten, in denen man das Smartphone auf sich beruhen lässt, nicht alle zehn Minuten reinschaut, sondern sich ganz bewusst in der analogen Welt bewegt.
Prosumenten: Menschen sind gleichzeitig Produkt und Konsument
Sie nennen den Begriff der Prosumenten - Menschen, die gleichzeitig Produkt und Konsument sind. Wie meinen Sie das?
Wir kaufen Hardware, aber keinen Anteil an den Plattformen, auf denen wir uns bewegen. Der große Sog der sogenannten Sozialen Medien hängt sicher mit dieser Verlockung zusammen, kostenlos an großen Kommunikationsplattformen beteiligt zu sein. In Wahrheit bezahlen wir dafür, aber nicht durch eine finanzielle Gegenleistung im unmittelbaren Sinn, sondern dadurch, dass wir mit der Teilhabe an diesen Plattformen ihnen unsere Daten überlassen. Wir sind Konsumenten, aber gleichzeitig das Produkt, mit dem Internetfirmen wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich arbeiten.
Ist es gerade für jüngere Menschen überhaupt noch möglich, sich dem zu entziehen?
Es ist sicher nicht möglich, generell einen ethischen Rat zu geben, der sagt: Haltet euch fern davon! Sondern der Rat kann nur heißen: Geht damit bewusst und verantwortlich um. Achtet insbesondere darauf, wem ihr welche Daten zur Verfügung stellt.
Wie halten Sie das?
Ich halte mich zurück. Ich überlege, mit welchen Suchmaschinen ich arbeite, bei welchen Social Media ich beteiligt sein muss. Ich wähle diejenigen Möglichkeiten aus, bei denen ich geringere Gefahren sehe. Aber ich löse mich nicht aus allen digitalen Medien heraus. Das wäre in meiner Situation abwegig.
Sie bezeichnen das freimütige Preisgeben von Informationen als Selbstverletzung. Wie kann man die verhindern? Muss man so etwas in der Schule vermitteln?
Ich bin dezidiert der Auffassung, dass digitale Fähigkeiten in der Schule gezielt gefördert werden müssen. Dazu gehört auch die ethische Kompetenz, sein eigenes Verhalten kritisch zu prüfen und die Einflüsse, die von anderer Seite auf einen einstürmen, einschätzen zu können und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Dasselbe gilt auch für den Bereich der Familie, denn die Alltagsgewohnheiten, die sich damit verbinden, sind eine der größten Gefahren. Wie Alltagsgewohnheiten sich entwickeln, wird noch immer am stärksten in der Familie geprägt.
"Erschüttert darüber, wie klein Kinder mit Smartphones sind"
Manchmal sind es sogar die Kinder, die von ihren Eltern fordern, nicht immer nur mit dem Smartphone zu spielen, sondern auch einmal mit ihnen.
Diese Umkehrung gibt es. Wer mit wachen Augen im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, hat Grund zur Erschütterung darüber, wie früh Bezugspersonen die Kinder digitalen Medien ausliefern, wie klein Kinder sind, die bereits Smartphones in der Hand haben.
Viele sagen aber auch, es sei wichtig, Kinder früh an diese Technik heranzuführen - gibt es in Ihren Augen eine Altersgrenze für den Gebrauch von Smartphones?
Nach meiner Überzeugung haben digitale Instrumente im vorschulischen Bereich nichts zu suchen. Selbstverständlich weder in Kindertagesstätten und Kindergärten, noch im Spielbereich zu Hause.
Influencer werden von jungen Menschen als authentischer empfunden als klassische Produktwerbung, aber in aller Regel ebenso für ihre Werbung bezahlt. Sind Sie gegen jedes Influencertum, oder gibt es auch gute Influencer?
Es wäre abwegig zu fordern, dass es keine Influencer geben dürfe. Es ist eine höchst verantwortungsvolle Tätigkeit, und wenn sie nicht verantwortungsbewusst wahrgenommen wird, hat das beunruhigende Konsequenzen.
Glauben Sie, dass es dieses Bewusstsein gibt bei Influencern?
Ich fände es anmaßend, wenn ich das generell bestreiten würde. Ich gehe davon aus, dass sie genauso nachdenkliche Menschen sind wie andere, aber es gibt einen Sog: Sie reagieren darauf, welche Art von Echo sie bekommen. Wir wissen, dass einer der großen Mechanismen bei der Digitalisierung die Resonanz ist, die Antwort, das Like oder Dislike, und dass Menschen sich sehr leicht davon abhängig machen.
Sind wir unfreier geworden?
Angesichts der heutigen Möglichkeiten, eine ständige Verfügbarkeit und auch Kontrolle zu erzeugen - sind wir durch die Digitalisierung eine unfreiere Gesellschaft geworden?
Jedenfalls geben wir selber Teile unserer Freiheit auf, bei denen wir überlegen müssen, ob wir das tatsächlich wollen. Ein wichtiger Punkt: der Rückgang der Fähigkeit, sich mit einer Sache über längere Zeit zu beschäftigen. Dass wir zu selten über etwas in Ruhe nachdenken, halte ich für eine enorme Gefahr. Eine andere Gefahr besteht darin, dass wir in wachsendem Maß mit einem Ineinander von Wirklichkeit und virtueller Wirklichkeit konfrontiert sind. In diesem schrittweisen Abschied von der Realität liegt die Gefahr einer tiefgreifenden Desorientierung. Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion verschwimmt, die sich mit der Weiterentwicklung noch verschärfen wird. Es sei denn, wir steuern eindeutig dagegen an.
Dadurch ist auch die Gefahr von Täuschungen größer geworden. Ich denke an den Instagram-Account, der für die Widerstandskämpferin Sophie Scholl von öffentlich-rechtlichen Sendern entwickelt wurde. Damit sollte jungen Menschen die 1943 hingerichtete Studentin nähergebracht werden - später kam heraus, dass viele den Account für den einer echten, lebenden Person hielten und das Projekt nicht erkannten.
Gefahr finde ich dafür ein zu schwaches Wort. Es ist Irreführung, und diese Irreführung darf man keinesfalls zulassen. Ganz besonders dann, wenn es sich um Personen der jüngeren Zeitgeschichte handelt, die Schreckliches durchgemacht haben und dadurch Zeitzeugen und Vorbilder geworden sind.
Wobei es sicher gut gemeint war. Nur konnten die, an die sich der Account richtete, nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden.
Aber die Aufgabe der beteiligten Sender liegt genau darin, die Unterscheidungsfähigkeit zu stärken.
Es gibt die Angst vor einer Superintelligenz, die für den Menschen unbeherrschbar wird. An wen richten sich Ihre Appelle, dass die Herrschaft der Menschen über die Maschinen gewahrt sein muss?
Es betrifft in besonderer Weise die Wissenschaftler, die solche Möglichkeiten entwickeln und verantwortlich dafür sind, dass mit ihnen kein Missbrauch getrieben wird. Aber das muss politisch und rechtlich abgesichert werden. Jeder von uns ist aufgerufen, sich mit solchen Entwicklungen auseinanderzusetzen: damit ein gesellschaftliches und demokratisches Klima entsteht, in dem man gemeinsam Missbrauch eindämmen und verhindern kann.
Reicht es, wenn wir das in Deutschland tun, oder ist nicht die Gefahr groß, dass sich umstrittene Entwicklungen auch hierzulande durchsetzen können, wenn dies in Ländern wie etwa China geschieht - nach dem Motto "Wir müssen mithalten können"?
Wir dürfen unser Verhalten in solchen Fragen nicht von dem Verhalten beispielsweise Chinas abhängig machen. Wir sagen ja auch nicht, weil China keine Demokratie ist, verzichten auch wir darauf, in einer Demokratie zu leben. Wir müssen versuchen, internationale Verständigungen darüber herbeizuführen und China in solche Überlegungen einzubeziehen. Aber wir schwächen unsere eigenen Überzeugungen, wenn wir sie von der chinesischen Position abhängig machen.
Wolfgang Huber: "Menschen, Götter und Maschinen. Eine Ethik der Digitalisierung", 207 Seiten, C.H. Beck, 18 Euro
- Themen:
- Panorama