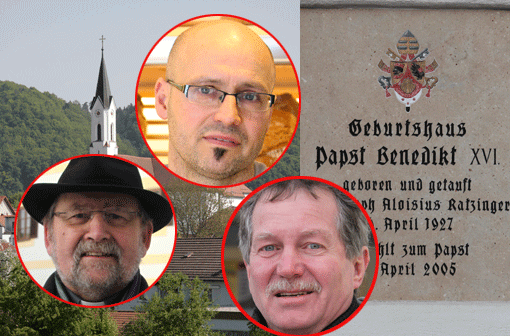Papst-Rücktritt: Das sagen die Marktler
Marktl am Inn - Marktgemeinderat Schneidermeier schaut skeptisch. Ob der 40-Tonner da steckenbleibt? Wäre ja nicht das erste Mal.
Der Lkw steht zwischen der Pfarrgasse und dem Geburtshaus des Papstes. Seine rote Plane knattert im Wind. „Wir besorgen’s Ihnen... aber richtig!“, steht darauf geschrieben. Der Laster kriecht voran. Jetzt merkt auch der Fahrer: Marktl ist nichts für Lastwagen, doch viele Navis weisen die heikle Durchfahrt als Abkürzung aus.
Marktl am Inn kennt sich aus mit Abkürzungen. Das Dorf hat es 2005 in nur einem Tag vom Kaff zum Kult-Ort gebracht. Danach ging’s langsam bergab. Und viel hängengeblieben ist nicht.
Marktl am Tag des Papst-Rücktritts: Null Grad, vorwiegend bewölkt. Und ein Wind! Der weht den Schnee von den Dächern und nervt die Journalisten auf dem Marktplatz. Drei Tage davor hat er ein Hoftor umgeblasen und ein Kind erschlagen. Sie haben den Kinderfasching deshalb abgesagt.
Der Ort wirkt wie leergefegt. Unterhalb der Kirche St. Oswald ist keine Seele zu sehen. Der Metzger: zu. Der zweite Bäcker: zu. Der Herrenfriseur: zu. Ein Hund jault laut und verschluckt sich dann. Man hört ihn würgen.
Auch heute kommt kein Tourist hierher, dabei wäre heute doch was los. Der Bürgermeister (SPD) gibt Interviews, der Pfarrer gibt Interviews, sogar Marktgemeinderat Walter Schneidermeier (SPD) gibt Interviews. Er sagt, zur Papst-Wahl 2005 seien die Medien „aus der ganzen Welt“, nach Marktl gekommen. „Heute ist’s halt halb Europa.“ Er sieht das Ganze locker, weil Marktl wenig zu verlieren hat durch den Rücktritt Benedikts. Sie haben ja auch nie wirklich was gewonnen.
„Wirtschaftlich war’s nix“, sagt Schneidermeier. „Eher im Gegenteil.“ Als Joseph Ratzinger zum Papst erhoben wurde und Marktl (364 Meter über Normalnull) dem Himmel plötzlich ganz nahe kam, waren auf einmal auch die Touristen da: 200000 Menschen wollten im Wahljahr und dem danach das Geburtshaus des Papstes sehen. Die Kirche St. Oswald von 1875. Und des Papstes Taufbecken, das jahrelang vergessen im Kirchengarten lag und 2006 „wieder seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß als Taufbecken“ aufgestellt wurde, wie es auf Marktls Homepage heißt.
Die 2700-Einwohner-Gemeinde reagierte auf den Ansturm der Frommen: Sie baut einen Busparkplatz, dazu eine Haltestelle und die Touristen-Information im Bürgerhaus, in der Schneidermeiers Frau arbeitet. „Das hat alles mehrere hunderttausend Euro gekostet“, sagt er. Sein Blick führt den Satz weiter: Nur gebracht hat das Ganze leider wenig. „Es gab bei weitem nicht so viele Einnahmen.“ Die Kerzen und das ganze Glump von der Touristen-Info, die haben grad mal die Unkosten gedeckt. „Wir sind bekannt, aber nicht reich“, sagt Schneidermeier. Das sollen diejenigen ruhig wissen, die sagen, Marktl habe den Papst-Ruhm ausgezuzelt wie eine Weißwurst.
Die Touristen seien ja immer nur ganz kurz geblieben, sagt Schneidermeier. Raus aus dem Bus, mal kurz durchs Dorf, vielleicht eine Benedikt-Schnitte (mit Fettglasur) und ein „Papst-Bier“ (das der Pfarrer „greislig“ findet) und dann wieder: ab nach Altötting. Wallfahrt kompakt.
Marktl hätte die vielen Gäste eh nicht aufnehmen können. Übernachten könne man hier schon, sagt Schneidermeier, „aber ab einem Bus wird’s schon eng.“ Das Gasthaus am Platz, die „Alte Post“, hat auch während des Booms nicht wieder aufgemacht. Es ist so runtergekommen, dass die Marktler beim Papst-Besuch 2006 die Zuschauertribüne davor platzierten.
Seit Jahren suchen sie eine Verwendung für diesen „Schandfleck“, sagt Schneidermeier. An diesem Tag ist das Gasthaus wieder Thema im Marktgemeinderat – neben Themen wie dem Zuschussantrag der Hubertusschützen oder der Verordnung „über das freie Herumlaufen von großen Hunden“.
Eine Studie habe ergeben, dass die Bausubstanz okay sei, sagt Schneidermeier. Es will nur keiner was mit der okayen Bausubstanz anfangen.
Der Bäcker arbeitet jetzt hauptberuflich im Chemiewerk
Ist ja kein Wunder, wenn sogar der Bäckermeister nur nebenbei bäckt. Ralf Winzenhörlein kann von der „Benedikt-Schnitte“ längst nicht mehr leben. Jetzt hat er einen Job bei Wacker Chemie.
Auch die Dorffrömmigkeit hat Benedikt XVI. nicht gefördert – sagt der Pfarrer. Josef Kaiser kannte den Papst schon, als er noch Kardinal war. Und 2006 durfte er ihn in St. Oswald empfangen. Da habe er sich wie jeder andere Mensch noch gefragt: „Was sagt man einem Papst?“ Dann habe er gemerkt, „dass er ein ganz einfacher Mensch ist, der bairisch spricht“.
In den Jahren nach dem Besuch ist Josef Kaisers Kirche aber nicht voller geworden. An manchen Sonntagen vielleicht, da hätten öfters mal Busgruppen die Messe besucht. „Aber die Marktler“, sagt Kaiser, „die sind nicht mehr geworden.“
- Themen:
- Benedikt XVI
- Päpste
- SPD