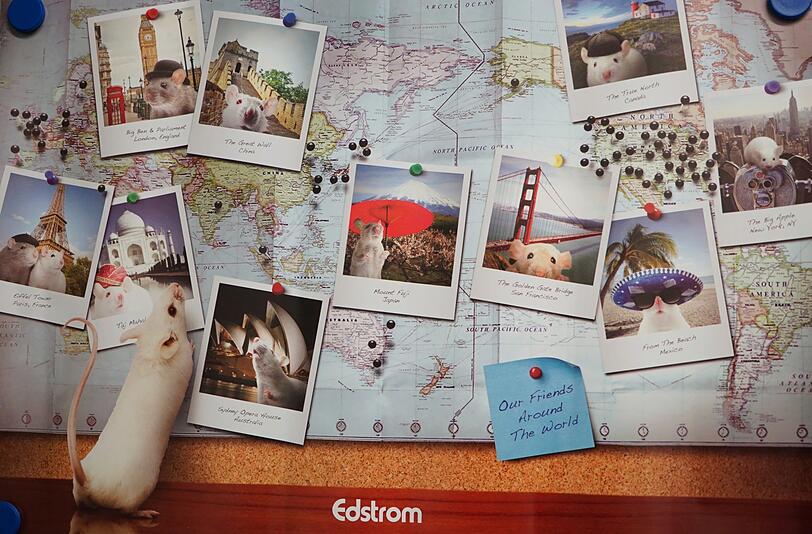Leben und sterben - für Menschenleben
München – Wenn die Fliegen in Massen kommen, ist das normalerweise der Anfang vom Ende. In Martinsried bedeutet der Einzug der Fliegen in der kommenden Woche: Es beginnt. Die Drosophila melanogaster – oder auch Taufliege – ist die erste Tierart, die in den Komplex aus Biomedizinischem Zentrum (BMC) und dem Zentrum für Angewandte Zellforschung der LMU einzieht.
In einigen Monaten werden in dem grellgrünen, komplexen Bau insgesamt etwa 500 Menschen für die Forschung arbeiten, bis Anfang 2016 sollen die 60 Forschergruppen eingezogen sein. Einige davon werden auch mit Tieren arbeiten, dann wird es hier neben den Fliegen noch Krallenfrösche geben, Zebrafische, Ratten und Kaninchen. Und vor allem: Mäuse. Etwa 20 000.
Denn Mäuse als Versuchstiere – oder „Tiermodelle“ wie sie hier genannt werden – sind nach internationaler Übereinkunft von Wissenschaftlern der „beste Kompromiss“ zwischen dem Bestreben, in Experimenten einen Menschen zu simulieren, und dem Wunsch, die Modelle effizient und kostengünstig handhaben zu können, erzählt Peter Becker.
Er ist Forschungsleiter des Zentrums und Baubeauftragter, außerdem wird er hier selbst an Taufliegen forschen. 20 000 Mäuse, das klinge viel, sagt er, „aber wir werden deutlich mehr Tiere hier haben, als wir verwenden“. Das BMC tauscht Mausstämme aus mit anderen Einrichtungen, züchtet für den Verbrauch anderer mit und bringt auch Mäuse unter, die bisher dezentral in kleineren Einrichtungen im Raum München gehalten wurden.
Kein Forscher darf den Bereich betreten, in dem die Tiere leben
Die Versuchsräume mit ihrer speziellen Belüftung und den kunststoffbeschichteten Wänden für eine einfachere Desinfizierung sind so kürzlich erst fertig geworden, dass noch die Visitenkarte des Kälteanlagen-Bauers in einem Versuchsraum liegt. Ein Rohrbruch im Frühjahr hatte auch die Kellerräume unter Wasser gesetzt und den Zeitplan um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. 125 Millionen Euro hat allein der Bau von BMC und Zellzentrum nach LMU-Angaben gekostet. Ein Großteil des Gebäudes mit 18 000 Quadratmetern Nutzfläche für Forschung und Lehre wurde vom Staat Bayern finanziert, aber auch Bundesfördermittel stecken darin.
Im Keller sind die Flurböden zur Orientierung in Knallgrün oder Feuerrot gehalten, damit die Mitarbeiter der verschiedenen Forschungsbereiche sofort merken, wenn sie ihren Bereich verlassen. Kein Wissenschaftler darf in den Maus-Zucht-Bereich, auch wenn dort seine eigenen Versuchstiere untergebracht sind, und die Tierpfleger haben nichts zu suchen im Experimental-Bereich.
Es herrschen strenge Hygienevorschriften: Wer den Keller betreten will, muss seine Straßenkleidung gegen grüne Laborkleidung tauschen. Bevor er in den Arbeitsbereich darf, muss er die Schuhe wechseln, die Hände desinfizieren, zwei Paar Schutzhandschuhe anziehen, Haube und Schutzanzug. Und dann für zwei Minuten unter die Luftdusche.
Lesen Sie auch: Proteste gegen das Krebsforschungszentrum rechts der Isar
Alle benötigten Materialien werden entweder mit Wasserstoffperoxid begast und so von Keimen gereinigt, oder autoklaviert – großer Hitze (121° Celsius) und hohem Druck ausgesetzt.
Die Tiere selbst sind auch so untergebracht, dass sie möglichst mit keiner Verunreinigung in Berührung kommen. Die Kunststoffkäfige sind leicht gelb eingefärbt, damit das helle Laborlicht die Tiere nicht stört, ein Häuschen ist jeweils darin, der Boden ausgelegt mit Holzgranulat. Kleine Röhren gibt es und Zellstoffplatten, aus denen die Tiere sich „ein Nest bauen und individuell gestalten können“, erklärt der Tierschutzbeauftragte des Komplexes, Thomas Brill.
Die Größe der Käfige variiert, nach gesetzlichen Vorgaben bemessen – auf „Quadratzentimeter Bodenfläche pro Gramm Tier“, sagt Brill.
Tierschützer kritisieren den Bau aber trotz seiner geplanten Effizienz und Gesetzmäßigkeit. „Es ist natürlich ein Fortschritt, wenn Tiere nicht mehr weit transportiert werden müssen“, sagt Christina Wagner vom Tierschutzbund, „und es mag auch dazu beitragen, dass weniger Tiere verwendet werden. Wir hätten uns aber gewünscht, dass ein wissenschaftlich fortschrittliches Land wie Bayern mal in ein Forschungszentrum investiert, das zeigt: Wir können ganz ohne Tierversuche forschen.“
Die Verwendung bringt immer auch mit sich: das geplante Töten
Und dann wäre da noch die Frage, wie ein Forscher umgeht mit der Verantwortung. Wenn zum Beispiel ein Fehler eine Versuchsreihe verunreinigt, müssen die Tiere „entsorgt“ werden. „Wir bemühen uns ungeheuerlich, Fehler zu vermeiden, das sieht man hoffentlich“, sagt Forschungsleiter Becker. „Menschen sind keine Roboter, Fehler kommen vor. Aber wir bemühen uns, jedes Tier in dieser Haltung möglichst zweckgemäß zu verwenden.“
Verwenden bringt aber auch immer noch eines mit sich: das geplante Töten danach, um etwa Organe zur Untersuchung zu entnehmen oder das Blut abzuzapfen für eine Analyse. Welche Variante der Forscher für das „fachgerechte und tierschutzkonforme Töten“ wählt, ist ihm überlassen. Das Ersticken mit Kohlenstoffdioxid ist die am häufigsten verwendete, die Überdosis eines Anästhetikums eine andere Möglichkeit. Auch Dekapitation ginge: Köpfen.
So etwas kann einen Menschen eigentlich nicht unberührt lassen, selbst wenn er Tierversuche für notwendig hält. Darüber sprechen will aber niemand. Die Sorge vor Angriffen, verbalen und physischen, sei zu groß, heißt es von der LMU. Viele der Forscher hätten Familie, die Kinder würden in Kita und Schule angefeindet.
Die Forschungsräume liegen übrigens alle im zweiten Untergeschoss, nur in die Waschhalle kommt durch ein paar schmale Fenster etwas Tageslicht. Den ganzen Tag unter Tage, das ist natürlich für die Mitarbeiter nicht angenehm und auch arbeitsrechtlich schwierig. „Aber vorm Gesetz“, sagt Eckart Thein, der zentrale Tierschutzkoordinator der LMU, „ist das Tier nun mal mehr wert als der Mensch.“