Leben mit der Sucht: Was tun, wenn der Partner alkoholkrank ist?

München - Am ersten Schultag ihres Sohnes ist ihr Partner auf Entzug. Sie lächelt es weg, erfindet eine Ausrede für ihn. Als sei sie sein Bodyguard, seine Komplizin, beschreibt es Julia Kessler (46) im Rückblick. Seine Sucht schwappt immer mehr auch in ihr Leben, zieht sie in einen Strudel, verwandelt sie in eine Co-Abhängige.
Alkoholabhängigkeit: Prozess geschieht schleichend
All das passiert schleichend. Erste - kleine und größere - Anzeichen flackern immer wieder auf. Etwa als ihr Freund sie einmal betrunken nachts anruft, um sich zu versichern, dass die Verabredung am nächsten Tag sicher klappe.

Oder als sie einmal unbedarft aus dem Glas ihres Freundes trinken will - doch beim ersten Schluck merkt: Das ist kein Wasser. Sondern ein halber Liter Wodka.
Knapp sechs Jahre hat Kessler in einer Beziehung mit einem Alkoholkranken gelebt. Entzug, Rückfall, Entzug, Rückfall. Und dazwischen ganz viel Hoffnung, dass doch noch alles gut werden wird. Sie selbst ist es, die irgendwann den Teufelskreis durchbricht.
Julia Kessler hilft Angehörigen in einer Selbsthilfegruppe
Heute arbeitet sie als Coach und hilft beim Blauen Kreuz in München anderen Angehörigen in einer Selbsthilfegruppe. Gerade ist ihr sehr offener Ratgeber über ihre Erfahrungen mit Co-Abhängigkeit erschienen. Ihr Ex-Partner hat das Buch als Erster gelesen - und er gab seinen Segen dazu.
AZ: Frau Kessler, Apfelschorle oder Aperol zum Feierabend - mögen Sie noch Alkohol?
JULIA KESSLER: Diese Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Mir geht es um einen bewussteren Umgang mit Alkohol, und nicht darum, ihn grundsätzlich zu verteufeln. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand genussvoll und kontrolliert trinken kann und das auch tut. Nur die Schattenseiten von Alkohol werden in unserer Gesellschaft zu gern unter den Teppich gekehrt.
Sie waren mit einem alkoholkranken Mann liiert. Wie hat das Ihr Leben verändert?
Die Dynamik ist immer ähnlich: Der Co-Abhängige versucht, zu 100 Prozent die Kontrolle über die Sucht des anderen zu erlangen. Man fühlt sich verantwortlich für die Emotionen des anderen, für seine Handlungen, für die Konsequenzen seines Trinkens. Man verliert dadurch aber sein eigenes Leben, sein Wohlbefinden und seine Energie. Das ganze Leben wird durch die Sucht unberechenbar. Ich habe mich zum Beispiel gefragt: Was wird wieder passieren, wenn ich nach Hause komme? Und was, wenn er nach Hause kommt?

Kessler: "Man isoliert sich immer mehr, um auf den Partner aufzupassen"
Sie haben sich wie der Bodyguard des Süchtigen gefühlt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ist das ein typisches Verhalten von Angehörigen?
Ja, der Angehörige wird auch zum Symptomträger: Angst, Scham, Isolation. All das sind Symptome der Co-Abhängigkeit und Nährboden zugleich. Je mehr ich in die Scham gerate, desto mehr isoliere ich mich, damit es niemand mitbekommt. Ich lade niemanden mehr ein, ich gehe nicht mehr zu Verabredungen, damit ich aufpassen kann, dass mein Partner daheim nicht trinkt. Oder dass er nicht die Treppe hinunterstürzt oder sich betrunken ins Auto setzt. Je mehr meine Angst übernimmt, desto weniger Verantwortung trägt der Suchtkranke, denn ich übernehme ja auch seine. Als Co-Abhängiger denkt man, diese Strategien helfen, aber sie bewirken genau das Gegenteil.
Wann würden bei Ihnen mit Ihrem heutigen Wissen die Alarmglocken schrillen?
Das war ein schleichender Prozess, kein Paukenschlag von heute auf morgen. Ganz grundsätzlich würde ich sagen: In dem Moment, wenn Alkohol in meiner Beziehung und meinem Leben Probleme schafft und ich mir darüber Gedanken mache, ist es ein Problem. Wenn ich merke, dass mein Partner heimlich trinkt, wenn er es leugnet, aggressiv wird, (leere) Flaschen versteckt. Dann muss man einsehen: Hier ist das genussvolle Trinken überschritten.
"Alkoholismus hat viele Gesichter und ist sehr individuell"
Warum ist Alkoholsucht ein Tabu und es so schwer, sich das Problem einzugestehen?
Man hört oft, mein Mann ist kein Alkoholiker, er macht ja noch seinen Job oder trinkt nur abends oder nur teuren Rotwein. Alkoholismus hat viele Gesichter und ist sehr individuell. Das Klischee des Alkoholikers ist aber immer noch das des Menschen, der mit billigem Wodka unter der Brücke steht und seine Arbeitsstelle verloren hat. Es wird oft mit Menschen assoziiert, die willensschwach sind. Das stimmt einfach nicht! Ich kann immer noch erfolgreich und trotzdem schon alkoholkrank sein. Das zeigt: Die Krankheit ist erst einmal schwer greifbar. Dazu kommt, dass der Betroffene die Krankheit leugnen wird, damit er weiter trinken kann. Bis die Wahrheit auf dem Tisch liegt, können Jahre ins Land ziehen.
Aber irgendwann lässt es sich nicht mehr leugnen?
Von Alkoholismus betroffen zu sein, ist kein Grund, sich zu schämen. Aber einer, ins Handeln zu kommen. Denn man kann diese Krankheit nicht aussitzen. Und auch die Co-Abhängigkeit - diese Menschen sind irgendwann völlig erschöpft und vor dem Zusammenbruch oder brechen zusammen - geht nicht weg, wenn man in der alten Dynamik bleibt.
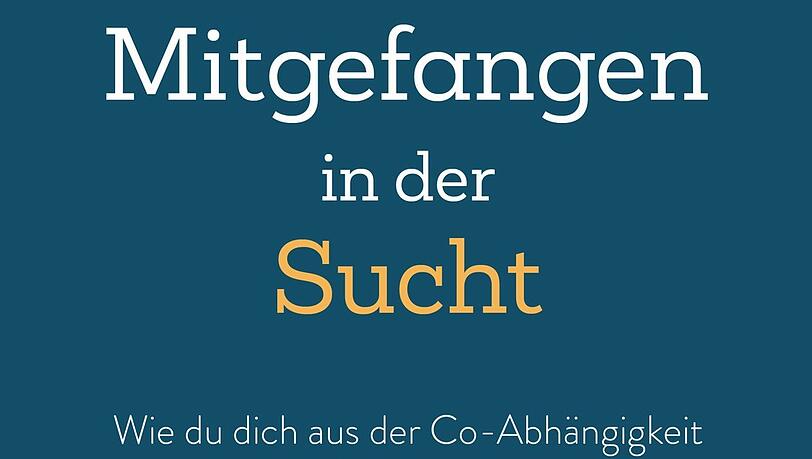
Was hat Ihnen geholfen?
Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass dieser Weg nicht der richtige sein kann, dass es immer schlimmer wird und ich mich in der Wiederholung der Wiederholung befinde. Ich habe mir daraufhin Hilfe geholt bei Rolf Bollmann, der den Kurzfilm "Ein Glas Wasser" über seinen Weg zur Abstinenz gedreht hat. Durch ihn ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass ich co-abhängig bin.
"Nur der Suchtkranke selbst kann die Verantwortung für seine Krankheit übernehmen"
Sich die Wahrheit vor Augen zu führen, ist also der erste Schritt. Und dann?
Der Angehörige muss versuchen, loszulassen und dem Betroffenen die Verantwortung für seine Sucht zurückzugeben. Zu sagen: Ich kann diese Sucht nicht kontrollieren, so sehr ich es mir auch wünsche. Wenn der andere trinken will, wird er trinken. Wenn man das erkennt, kommt bei vielen natürlich die Angst vor den Konsequenzen: Möchte ich, dass jeder weiß, dass etwa meine Tochter, eine erfolgreiche Ärztin, Alkoholikerin ist? Oder: Was denken die Nachbarn? Dürfen meine Kinder dann noch mit anderen spielen? Und so weiter. Man kann dann nur anfangen, an den eigenen Ängsten und Schuldgefühlen zu arbeiten und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Fühlt es sich nicht so an, als würde man den Partner oder Angehörigen im Stich lassen?
Das ist genau der Nährboden, auf dem sich Co-Abhängigkeit stabilisieren kann. Der Punkt ist: Es gibt einen einzigen Menschen, der die Verantwortung für die Sucht übernehmen kann, und das ist der Suchtkranke selber. An mir liegt es nur zu entscheiden: Erschaffe ich ein Umfeld, in dem er weiter trinken kann und keine Verantwortung übernehmen muss - und gehe ich letztlich mit ihm unter? Ich lasse die Person nicht fallen, sondern ich gebe ihr ihre Verantwortung zurück.
Wie hat Ihr Partner reagiert?
Es war ein langsamer Abnabelungsprozess. Je mehr ich ihm seine Verantwortung wieder überlassen habe, desto mehr Kraft und Selbstbewusstsein habe ich selbst wieder zurückgewonnen und konnte wieder für mich einstehen. Bei ihm hat es nachhaltig zu diesem Zeitpunkt nicht geklappt mit der Abstinenz.
"Das Blaue Kreuz ist eine erste Anlaufstelle für Hilfe"
Wie schätzen Sie das Hilfsangebot für Angehörige von Alkoholkranken ein?
Aus meiner Erfahrung muss hier noch viel getan werden. Der Fokus liegt auf dem Kranken, was auch wichtig ist. Aber das Angebot für Angehörige fällt mau aus. Im Schnitt kommen auf einen Alkoholiker drei Co-Abhängige. Es sind also viele Menschen, für die es schwer ist, wirklich Hilfe zu bekommen. Anfangs hat mir der Therapeut meines Partners einfach Antidepressiva verschrieben, damit ich weiter funktioniere. Kein Wort von Hilfsangeboten. Das war überhaupt nicht zielführend.
Sie leiten jetzt selber eine Gruppe für Angehörige in München. Warum?
Ich hoffe, dass meine Erfahrung anderen hilft und ihren Leidensweg verkürzt. Jeder und jede, die mich anrufen, freut mich, denn sie haben es geschafft, aus dieser Scham, Angst und Isolation herauszutreten und die Wahrheit auszusprechen.
Wie muss man sich solche Treffen vorstellen?
Das Blaue Kreuz ist eine erste Anlaufstelle. Hier wird den Angehörigen erklärt, dass auch sie Hilfe benötigen. Die Gruppen sind völlig gemischt: die Frau, bei der der Mann trinkt, der Mann, bei dem die Frau trinkt, Studenten mit alkoholkranker Mutter. Ich mache aufgrund der Corona-Regeln zwei Gruppen und mit ihnen arbeite ich und begleite sie. Sie erzählen von sich, jeder steht an einer anderen Stelle in seinem Prozess.
"Man kann nicht ankommen, wenn man nicht losgeht"
Kommen seit der Corona-Krise mehr Betroffene?
Ich habe die Gruppe erst während der Pandemie gestartet, daher lässt sich das schwer beurteilen. Ich kann nur sagen: Die Gruppe wird immer voller. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Familien eine Sucht durch die Corona-Beschränkungen noch mehr um die Ohren fliegen kann, wenn man nur aufeinandersitzt.
Was möchten Sie Menschen sagen, die in so einem toxischen Strudel feststecken?
Man kann nicht ankommen, wenn man nicht losgeht. Das bedeutet nicht, dass man sich trennen muss und gedanklich gleich in ein Horror-Szenario springt, sondern dass man sich für den Gedanken öffnet, sich Unterstützung zu suchen. Es gibt eine Alternative für die Realität, in die man sich verstrickt hat. Es lohnt sich, loszugehen! Und es bitte nicht davon abhängig machen, dass einem der noch uneinsichtige Alkoholkranke auf die Schulter klopft, denn der wird eher dagegen wettern.
Sollte man es ihm denn sagen oder sich erst einmal heimlich Unterstützung suchen?
Gut wäre es natürlich schon, wenn man an den Punkt kommt, ihm das mitzuteilen. Wenn ich mich das aber erstmal nicht traue, weil er vielleicht ausrastet, sage ich: lieber heimlich als gar nicht! Ziel sollte aber sein, für sich einzustehen.
Alkoholmissbrauch: Fünf Trinkverhalten
Alpha-Trinker: Der Alpha-Trinker ist laut Julia Kesslers Buch ein Problemtrinker. "Er greift zum Alkohol, um sich zu entspannen und den Ärger herunterzuspülen." Er sei ein Konflikttrinker und deshalb gefährdet. "Obwohl er eine seelische Abhängigkeit zeigt, wird er nicht den Alkoholikern zugerechnet."
Beta-Trinker: Der Beta-Trinker ist demnach ein Gelegenheitstrinker unter dem Einfluss seines Umfelds. Abhängig ist er nicht, aber gefährdet.
Gamma-Alkoholiker: Diese Form gilt als suchtkrank. Er könne das Trinken nicht mehr steuern und habe die Kontrolle über den Alkoholkonsum verloren. "Sein Körper verlangt nach Alkohol. Dennoch kann ein Gamma-Alkoholiker durchaus längere, manchmal sogar monatelang andauernde Alkoholpausen haben."
Delta-Alkoholiker: Er wird dem Buch zufolge auch Spiegeltrinker genannt. Was das heißt? "Er muss seinen Blutalkoholspiegel konstant halten und erleidet schwere Entzugserscheinungen, wenn er nicht trinkt." Er ist demnach schwer alkoholkrank und zeigt keinerlei Abstinenzfähigkeit mehr.
Epsilon-Alkoholiker: Quartalssäufer - dieser Begriff ist wohl geläufiger. "Er neigt zu schweren Exzessen und ist dann über Tage betrunken. In den Phasen dazwischen trinkt er oft über Wochen nichts und hat auch nicht das Bedürfnis danach. Auch er ist alkoholkrank."
Selbsttest: Sich selbst hinterfragen
Die Autorin Julia Kessler gibt in "Mitgefangen in der Sucht" persönliche Einblicke, erklärt Hintergründe zum Thema Alkoholsucht und hat auch zahlreiche Abschnitte, mit denen sich Angehörige selbst hinterfragen und die Situation abschätzen können. Eine kleine Auswahl:
- Fühlst du dich für die Emotionen und Handlungen eines anderen (alkoholkranken) Menschen verantwortlich?
- Übergehst du deine eigenen Bedürfnisse immer selbstverständlicher?
- Hast du aufgrund der Sucht eines anderen Menschen Strategien entwickelt, die dir selber extrem schaden?
- Glaubst du, du könntest oder müsstest den nächsten ersten Schluck verhindern?


