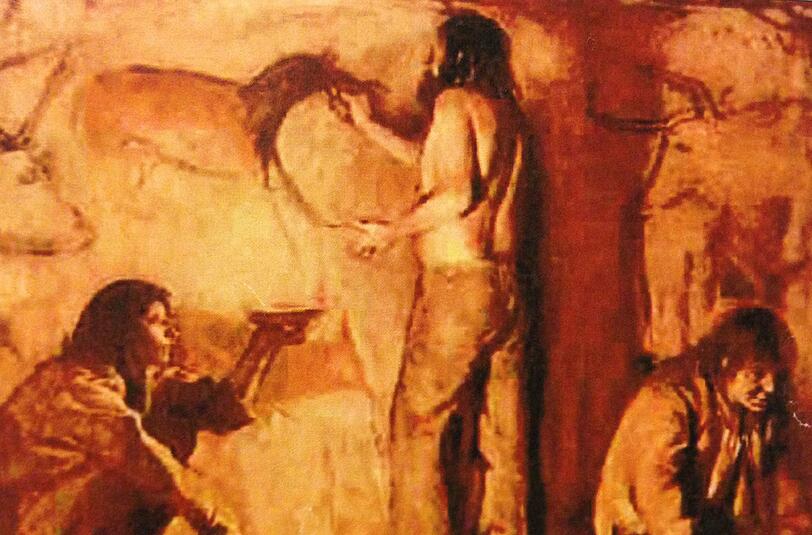4400 Jahre alt! Das ist der älteste Münchner
Der Fund eines Frauenschädels aus der Bronzezeit begeistert Archäologen. Doch sie ist nicht die älteste Münchnerin. Der starb nämlich in Sendling an der Pilganserstraße – als Künstler und Kämpfer. Sein Schädel lagert in einem Stahlschrank in der Anthropologischen Staatssammlung.
München – Der neue Fund unter der Residenz hat die Archäologen elektrisiert. Ein Grab aus der späten Bronzezeit – mitten in der Altstadt sind sie auf derart alte Knochenreste noch nie gestoßen.
Die Frau, die vor 3000 Jahren im heutigen Apothekenhof bestattet wurde, war wohl 40 bis 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß und womöglich eine wohlhabende Bauersfrau – das ergaben erste Untersuchungen.
Nach ihrem Tod ist sie verbrannt worden. Ihre Asche, übrig gebliebene Knochenteile, wertvolle Gewandnadeln aus Goldbronze und Tongefäße für Bier, Honigwein und Speisen wurden zusammen in ihr Grab gelegt - und Ende Mai bei Bauarbeiten zufällig entdeckt. Ein aufregender Fund, durch den die Archäologen und Anthropologen wieder ein Stück mehr erfahren werden über das Leben unserer Münchner Altvorderen.
Und doch: Der älteste Münchner Bewohner ist die Dame von der Residenz nicht. Denn der starb in Sendling schon rund 1400 Jahre vor ihr – vor 4400 Jahren! Die Sensations-Entdeckung verdanken wir – wie jetzt an der Residenz auch – Kanalarbeitern.
Die hatten im Juli 1906 an der Plinganserstraße in Sendling die Straße aufgegraben. Plötzlich, vor der Hausnummer 124, stößt ein Arbeiter auf seltsame Tonschalen. Gelb-braune Holzteile schimmern aus dem Erdreich - oder sind das etwa Knochen? Dann kommen kleine, grünliche Metallteile zum Vorschein - und: ein Schädel.
Friedrich Sprater, damals Chef-Ausgräber der Prähistorisch-Anthropologischen Staatssammlung, der wenig später vor Ort ist, ist sprachlos: 141 Gräber aus dem 7. Jahrhundert findet er, aneinandergereiht an der Sendlinger Fundstelle.
Und dazwischen: Sechs Tote aus längst vergangenen Zeiten. Frauen und Männer, hockend begraben vor 4400 Jahren. Es sind die ältesten Skelette Münchens - die Gebeine der wahrscheinlich ersten Münchner Siedler. Eine absolute Sensation.
Schon in der Jungsteinzeit also lebten Menschen in München! Lang bevor die Syrer die Alphabet-Schrift erfanden, nur 400 Jahre nachdem die Ägypter Pyramiden bauten! Und natürlich längst, bevor Herzog Heinrich der Löwe 1158 nach Jesus Christus das heutige München gründete.
Wer aber war er, der erste Münchner? Wie hat er gelebt? Wo kam er her? Der Oberkonservator der Anthropologischen Staatssammlung in München, Peter Schröter, inzwischen im Ruhestand, untersucht seit seiner Studienzeit die ältesten Münchner Gebeine, und er und seine Berufskollegen wissen immerhin so viel: Der Münchner Ur-Siedler – er ist eigentlich Niederösterreicher, eingewandert aus dem Donauraum.
Er war bis 1,70 Meter groß, hatte einen breiten, hohen Schädel mit flachem Hinterkopf. Und er war ein talentierter Töpfer. Berühmt geworden sind die rot-weißen „Glockenbecher“, die die Alt-Münchner hinterlassen haben. Kunstvolle tönerne Trinkbecher in Form einer umgekehrten Glocke, reich verziert durch eingedrückte Kammstempel-Muster. Diese Kunstwerke haben unseren Altvorderen auch ihren Namen gegeben: „Glockenbecher-Leute“.
Ansonsten waren sie fleißige Bauern, die in Hütten und vermutlich in 50-Seelen-Dörfern lebten. Sie bebauten ihre Felder mit Gerste, Weizen und Emmer-Getreide, kochten Brei und backten Brot. Die Zeit der Jagd war für die sesshaften Glockenbecher-Leute passé. Sie hielten sich Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder und Hunde. Und sie waren geschickte Gold- und Waffenschmiede, die zu Pferd, mit Pfeil und Bogen, in den Kampf zogen. Aus Kupfer schufen sie scharf geschliffene Dolche, bearbeiteten Feuersteine und bauten raffinierte Fels- und Knochengeräte. Fein gearbeitete Gold- und Silberohrringe und Schmuck aus Eberzahn gaben sie ihren Toten mit ins Grab.
Dass unsere Ur-Ahnen auch als Händler unterwegs waren, liegt nahe: Den Bernstein für ihre Ketten müssen sie von der Nord- oder Ostsee bezogen haben, Metalle aus den Alpen, aus Thüringen oder dem Erzgebirge. Nur ihr soziales und religiöses Leben blieb bislang im Dunkeln. Lebten sie in Ein- oder Viel-Ehe? Waren Frauen in ihrer Gesellschaft bevorzugt? Ihr Totenritus weist möglicherweise darauf hin.
Und glaubten sie an einen Gott? Welche Vorstellungen hatten sie vom Jenseits? Auf solche Fragen konnten die Fundstücke keine Antwort geben – das Geheimnis nahmen unsere Ahnen mit ins Grab. Mindestens vier weitere Gräberfundstellen aus der Zeit der Glockenbecher-Leute sind in München aufgetaucht: In Berg am Laim, Moosach, Pasing, Zamdorf. Von dort sind fast nur Grabbeigaben erhalten. Keramik. Waffen. Schmuck.
Die sechs Sensations-Skelette aus Sendling – sie sind leider verschollen. Manche sind wohl schon auf der Baustelle vor 88 Jahren verloren gegangen, der Rest verschwand im Krieg. Einen Beweis für ihre Existenz an der Isar gibt es aber noch: Einen letzten Sendlinger Schädel: Er ruht, verpackt in einer Schachtel, in einem Stahlschrank des Magazins der Anthropologischen Staatssammlung - und wird, so nichts dazwischen kommt, vielleicht noch ein paar tausend Jahre überdauern.
- Themen: