Wien: Küsse in Gold
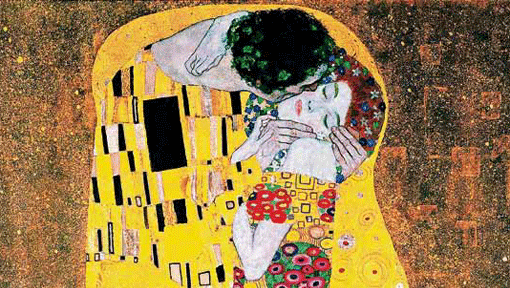
Schampus und Schnitzel, in möglichst großzügigen Portionen, dafür war er immer zu haben, der Quadratschädel mit dem lichten Haar. Abends ein glanzvoller Theaterbesuch oder ein rauschendes Fest mit Freunden, und stets ein „Techtelmechtel“ mit einer der zugänglichen Damen — so kannten die Wiener ihren Gustav Klimt. Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte er zum lebenden künstlerischen Inventar der Stadt. Er war blendend vernetzt, und wenn er einen Auftrag annahm, kassierte er schon mal den Gegenwert eines Einfamilienhauses: Ein Klimt-Porträt der Hausherrin über dem Kamin galt als Ausweis schicker Fortschrittlichkeit. Abseits der Öffentlichkeit aber war er ein disziplinierter Arbeiter, ein Künstler, der Dutzende von Skizzen fertigte, eher er ein Bild begann, und dann oft monatelang daran herumpuzzelte.
Jetzt steht ein Jubiläum an in Sachen Klimt. Am 16. Juli vor 150 Jahren wurde er in Wien geboren — das lässt sich die Donau-Metropole natürlich nicht entgehen, um ihn und sich groß herauszustellen. In der Stadt hat Klimt jede Menge farbenprächtiger Spuren hinterlassen. Im Burgtheater hat er die Decken der Treppenhäuser mit Theaterszenen versehen, im Kunsthistorischen Museum sind es Gestalten aus der Antike. Und in gleich mehreren Museen hängen die Bilder, von denen viele längst zu Ikonen des Jugendstils geworden sind: „Der Kuss“, der ganz in Gold zerbröckeln will. Die rot gelockte „Nuda Veritas“, die laszive „Judith“, die blau in blau ornamentierte „Emilie Flöge“ und der „Tod“ mit seiner Keule, der den Lebenden zur Seite tritt. Viel Gold schimmert da, alles fließt und wallt und rundet sich, Kleider lösen sich in Blasen, Wellen, Kringeln auf, und manchmal reicht die Innigkeit bis zum Kitsch. Aber das ist ja noch nicht alles: Auf Regenschirmen, Brillenetuis und Taschentüchern begegnet man dem Klimt’schen Universum, auf Uhren, Kulturtaschen und Puppengeschirr versinkt das goldene Paar im Kuss. Schon wahr: Manchmal wirken Klimts Bilder verbraucht.
Heute zählen Klimts Bilder zu den Ikonen des Jugendstils
Da gerät ganz in Vergessenheit, dass sie zu ihrer Zeit als neu, aufmüpfig, gar unerhört galten. Vielleicht muss man, um das zu verstehen, ganz in die Atmosphäre der „Boomtown“ Wien um 1900 eintauchen, damals die fünftgrößte Metropole der Welt. Architekten, Musiker, Maler und Schriftsteller fanden sich zusammen, stritten, träumten und waren alle so müde der Freitreppen, der heroischen Posen und der marmornen Helden, so überdrüssig der historisierenden Prunkbauten, mit denen der Kaiser ein halbes Jahrhundert lang die Stadt vollgestellt hatte. Neues musste her! Die Früchte dieses Aufbruchs finden die Besucher noch heute. Da ist zunächst und vor allem die Secession — und schon stößt der Besucher wieder auf Gustav Klimt. 1897 hatten er und eine Reihe anderer das konservative Künstlerhaus verlassen und ihre eigene Vereinigung gegründet.
Mit dem Gebäude aus weißen Kuben und viereckigen Säulen, über dem eine Kugel aus 3000 vergoldeten Lorbeerblättern leuchtet, gaben sie sich ihr eigenes Ausstellungszentrum. Die 14. Ausstellung 1902 war Beethoven gewidmet. Klimt gestaltete einen eigenen Raum mit einem Wandfries: Mit einem goldenen Ritter, einem affenartigen Ungeheuer, der Lyra spielenden Poesie und einem abschließenden „Kuss der ganzen Welt“ versuchte er Beethovens „Neunte“ in Bilder umzusetzen. Konservativen Kritikern stießen „der scheußliche Gorilla, die schamlosen Caricaturen der edlen Menschengestalt“ gewaltig auf. Aber auch nicht alle Progressiven waren von dieser Art Kunst begeistert. Der Architekt Otto Wagner sah sich keinesfalls als Freund des Weichen, Fließenden, das man Jugendstil nannte. „Einzige Herrin der Kunst ist die Notwendigkeit“, verkündete er. Gleichzeitig aber baute er für die neue Stadtbahn am Karlsplatz zwei Stationen mit rundem Dach und goldenem Fries und schönem, grünspanigem Kupferdach. In dem einen befindet sich heute ein Café, im anderen eine Dokumentation über den Architekten.
Wien-Besucher sollten sich einfach mal treiben lassen
Von Wagner stammt auch die klar gegliederte Fassade der Postsparkasse aus Marmorplatten und Aluminiumnieten, die von zwei Engeln bewacht wird. Und wer es schafft, bei seinem Bummel über den Naschmarkt den Blick zwischendurch von Räucherlachs, Marillenbränden und Nougatschnitten zu lösen und mal kurz zum Himmel zu gucken, entdeckt an der linken Wienzeile drei hohe Häuser mit Blumenfriesen und Löwenköpfen, runden Balkonen und goldenen Palmwedeln, entworfen und gebaut von Otto Wagner. Natürlich gibt es empfohlene Rundgänge auf den Spuren dieses Jugendstil-Wiens. Sie führen zur Buchhandlung Manz, der Adolph Loos mit Gold, Glas und Marmor ein elegantes quadratisches Gesicht verpasst hat.Sie streifen sein schmuckloses Loos- Haus am Michaelerplatz, das nach seiner Fertigstellung als „Mistkastl“ verunglimpft wurde. Und sie machen halt an der eleganten grauen Granitfassade des Zacherlhauses mit dem Erzengel Michael. Aber für Wien gilt noch mehr als für jede andere Stadt: bloß nicht sklavisch an einem Plan kleben bleiben! In Wien, diesem großartigen Menschenauflauf mit seinem kräftigen Sprachsalat, muss man sich ziellos treiben lassen.
Designerdirndln und handgenähte Aktentaschen konkurrieren in den Fenstern um Aufmerksamkeit, Spazierstöcke mit Silbergriff und sündteure Lampen, die noch vom Jugendstil-Star Josef Hoffmann entworfen wurden. Bei Julius Meinl lässt man sich handgeschöpfte Pralinés einpacken, an der Hofburg lauscht man dem Schmäh der Fiakerkutscher, im Stephansdom, dessen Inneres mit „coolem“ Licht ein wenig aufgekitscht wurde, kommt man kurz zur Ruhe. Und schon ist es Abend, Zeit für einen kleinen Imbiss. Wie wäre es mit ein paar dieser „unaussprechlich guten Brötchen“ bei Trzesniewski im Stehen: viereckige Brotscheiben mit klein gehacktem Käse-, Thunfisch-, Krabben- oder Speckbelag? Oder scheint ein Abstecher ins Kaffeehaus doch stilvoller, ins Café Griensteidl vielleicht? Da sitzt man dann bei Sacherwürstl mit Kren und einem Grünen Veltliner, lässt sich vom Kellner eine Zeitung bringen — und wer schaut einem über die Schulter: das güldene Paar von Klimts „Der Kuss“. Diesmal sind die beiden als Wandteppich verewigt. Man entkommt ihnen einfach nicht.
Anreise
Ab München fliegen Lufthansa ( www.lufthansa.com), Austrian Airlines ( www.austrian.com) und Niki Luftfahrt ( www.flyniki.com) direkt nach Wien. Flüge gibt es ab etwa 90 Euro. Vom Flughafen Schwechat aus gelangt man am schnellsten mit dem City Airport Train CAT in die Innenstadt ( www.cityairporttrain.com, Endstation Wien Landstraße). Mit der Wien-Karte haben Besucher 72 Stunden lang freie Fahrt mit U-Bahn, Bus und Tram und bekommen zahlreiche Ermäßigungen. Preis: 18,50 Euro, erhältlich bei der Tourist-Info.
Unterkunft
Das Boutique-Hotel Alma befindet sich in bester Innenstadtlage (1. Bezirk), die Zimmer sind mit Jugendstildekor versehen. Ein Doppelzimmer kostet 134 bis 193 Euro pro Nacht. Hafnersteig 7, Telefon 00 43 / 15 33 29 61, www.hotel-alma.com.
Das Hotel Urania liegt zentrumsnah im 3. Bezirk und verfügt über höchst unterschiedlich eingerichtete Zimmer. Ein Nacht im Doppelzimmer schlägt mit 70 bis 140 Euro zu Buche. Obere Weissgerberstr. 7, Telefon 00 43 / 17 13 17 11, www.hotel-urania.at.
Sehr stylish und mit traumhaftem Blick auf die Stadt wohnt man im von Jean Nouvel und Pipilotti Rist gestalteten Sofitel Stephansdom. Das Hotel liegt einen Steinwurf vom Schwedenplatz entfernt (2. Bezirk). Doppelzimmer ohne Frühstück ab 200 Euro, Praterstr. 1, Telefon 00 43 / 1 90 61 60, www.sofitel.com. Weitere Hotels über Wien Tourismus.
Essen und Trinken
Der berühmte Koch Ewald Plachutta hat vor kurzem ein weiteres Restaurant eröffnet: Plachuttas Gasthaus zur Oper serviert alle Klassiker, etwa Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Backhuhn. Walfischgasse 5—7, Telefon 00 43 / 15 12 22 51, www.plachutta.at. Das Theatercafé liegt neben dem Theater an der Wien und probiert gern Neues aus. Linke Wienzeile 6, Telefon 00 43 / 1 5 85 62 62, www.theatercafe-wien.at.
Sonderausstellungen Klimt 2012
Zum Jubiläum sind insgesamt 12 Sonderausstellungen geplant (www.wien.info). Auszug: Unteres Belvedere: Pioniere der Moderne Leopold Museum: Gustav Klimt. Eine (Zeit-)Reise Albertina: Klimt — Zeichnungen Wien Museum: Klimt. Die Sammlung Gustav Klimt im Kunsthistorischen Museum
Allgemeine Informationen
Wien Tourismus, Obere Augartenstraße 40, 1020 Wien, Telefon 00 43 / 1 21 11 40, www.wien.info

