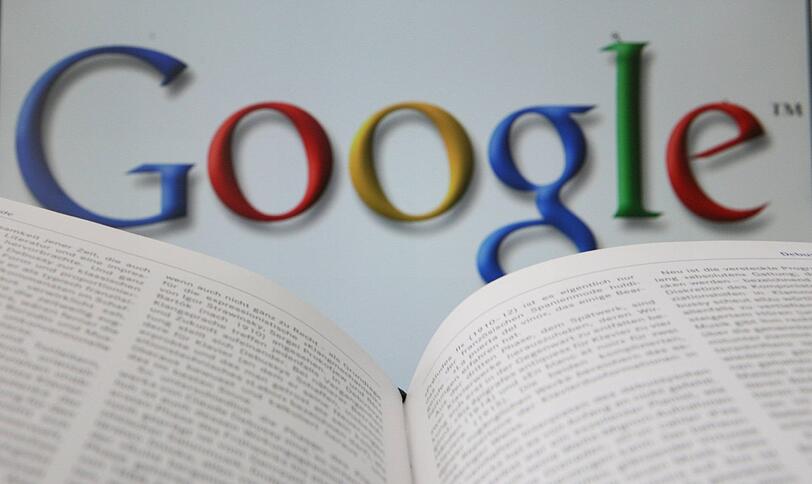Google darf Bücher scannen
Ein US-Gericht hat nichts dagegen, dass der Konzern Millionen von Büchern online zugänglich macht. Die Autoren sehen das Urheberrecht in Gefahr und wollen gegen das Urteil vorgehen
New York - Schon kurz nach dem Urteil wetterten die US-Buchautoren. Die Entscheidung sei eine „grundsätzliche Änderung des Urheberrechts“, so die Kritik. Grund für den Ärger ist das Urteil eines New Yorker Gerichts: Es hat Google das Scannen von Millionen von Büchern erlaubt. Der Suchmaschinen-Riese macht die Werke mit dem Dienst „Google Books“ im Internet zugänglich. Diese Digitalisierung verstößt nicht gegen das amerikanische Urheberrecht. Deutschland ist von dem Richterspruch nicht betroffen.
Google hatte bereits 2004 damit begonnen, Bücher in großen Online-Bibliotheken zu digitalisieren. Nutzer können dabei in den Büchern nach Begriffen suchen. Dann bekommen sie Ausschnitte von einigen Seiten Länge gezeigt. Google hat bereits ganze Arbeit geleistet: 20 Millionen Werke sind schon gescannt.
US-Richter Denny Chin findet das alles prima. „Meiner Meinung nach hat Google Books erhebliche Vorteile für die Allgemeinheit“, schrieb er in seiner Urteilsbegründung. „Es beschleunigt die Fortschritte in Kunst und Wissenschaft, während es gleichzeitig die Rechte von Autoren und anderen Kreativen berücksichtigt.“ Wie die „ganze Gesellschaft“ würden auch die Schreiber selbst profitieren, so Chin. Autoren und Verlage könnten sich über Google Books neue Einnahmequellen erschließen.
Die Schreiber sehen das ganz anders und glauben, dass Google mit seiner Online-Büchersammlung das Urheberrecht aushebelt. Schon im Jahr 2005 klagten US-Autoren. 2011 scheiterte ein ausgehandelter Vergleich am Veto eines Richters. 2012 legte Google den Streit mit den Verlagen bei. Die Autoren hielten die Klage aber aufrecht. Nach der Urteilsverkündung in New York kündigten sie nun an, den Richterspruch anzufechten. Nur die „erste Runde“ sei an Google gegangen, so der Geschäftsführer der Vereinigung „Authors Guild“, Paul Aiken.
Knackpunkt im Verfahren war das sogenannte US-Rechtsnorm „fair use“, übersetzt: „ angemessene Verwendung“. Google Books kopiere die Werke nicht, sondern erschaffe durch die Umwandlung des Textes in Daten zum Einsatz in der Forschung etwas Neues, urteilte das Gericht. Auch entziehe Google den Autoren kein Geld, weil es keine kompletten Kopien zugänglich mache.
In Deutschland gibt es „fair use“ nicht. Einige Bestimmungen können aber auch hier das Urheberrecht einschränken, beispielsweise das Recht, begrenzte Passagen in einem Werk zitieren zu dürfen. Außerdem dürfen Schulen und Universitäten Teile von Werken für die Lehre nutzen. Wegen der anderen Gesetzeslage beim Urheberrecht in Europa hatte Google sich schon im Jahr 2009 bereit erklärt, Zugeständnisse zu machen. Verlage und Autoren müssen zustimmen, bevor der Suchmaschinen-Riese die Bücher digitalisiert.
- Themen: