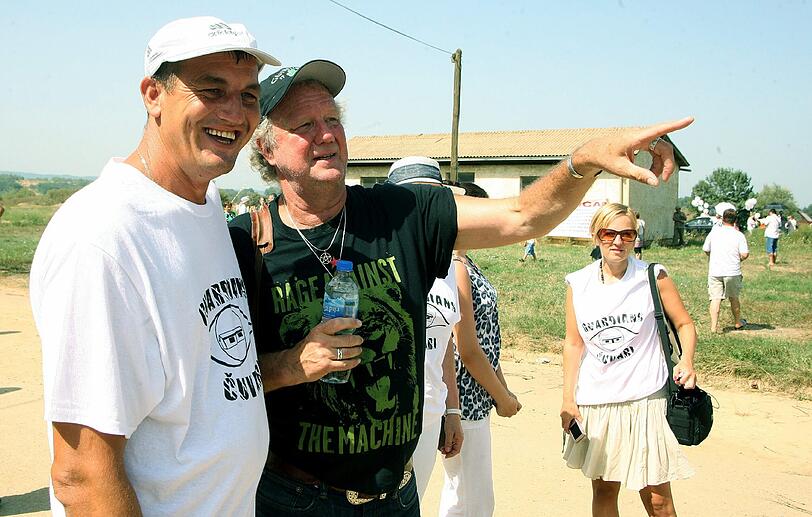Warum das Urteil gegen Karadzic nichts ändert
Am 24. März wird die Welt noch einmal an einen in Mitteleuropa schon fast vergessenen Konflikt erinnert. Endlich wird das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das Urteil gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadžic verkünden. Ihm werden während des Bürgerkrieges (1992 – 1995) die schwersten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zur Last gelegt. So soll er für die Ermordung von mehr als 8 000 muslimischen Jungen und Männern im ostbosnischen Srebrenica 1995 verantwortlich sein. Erst am 21. Juli 2008 war es gelungen, den mit Rauschebart und unter dem falschen Namen Dragan David Dabic als esoterischer Alternativmediziner in Belgrad praktizierenden Karadžic zu verhaften und nach Den Haag zu überstellen. Noch einmal drei Jahre lang dauerte es den bosnisch-serbischen General Ratko Mladic zu verhaften. Er hatte zeitweilig in derselben Straße wie Karadžic gewohnt.
"Alle waren verrückt" - also ist niemand schuld?
Doch während die Verhaftung Karadžic noch zu Autokorsos und Jubelfeiern in der Föderation Bosnien-Herzegowina geführt hatte, ließ die Verhaftung von Ratko Mladic die Menschen eher gleichgültig. Zu viel Zeit war verstrichen, zu offensichtlich war, dass die beiden Kriegsverbrecher, immerhin gejagt von allen westeuropäischen Geheimdiensten, über Rückhalt in höchsten serbischen Regierungskreise verfügt hatten. Zu lange schon hatte sich gezeigt, dass die Menschen im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas, der Republika Srpska, nicht bereit waren, Schuld für die Massaker zu übernehmen. Es ging und geht um die Relativierung der Schuld in einer Zeit, in der „alle verrückt waren“, wie es die serbische Seite gerne beschreibt.
Zwischen 1992 und 1995 starben im Bosnienkrieg und bei der Belagerung Sarajevos nach Angaben des internationalen Roten Kreuzes und des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag über 104 000 Menschen, darunter rund 68 000 sogenannte Bosniaken, 22 800 Serben und 8800 Kroaten. Blickt man nur auf die Zivilbevölkerung, so ist der prozentuale Anteil der bosniakischen Bevölkerung noch höher, 75 Prozent aller weiblichen, zivilen Opfer waren Musliminnen, viele von ihnen kamen in Todescamps ums Leben, in denen sie Monate, teils Jahre vergewaltigt worden waren.
Der britische Journalist Ed Vulliamy („The Guardian“) war gemeinsam mit zwei Kamerateams der Erste, der die Lager der bosnischen Serben im Sommer 1992 dokumentierte. Das Foto des ausgemergelten Bosniaken Fikret Alic hinter Stacheldraht im Lager Trnopolje wurde zum Sinnbild des Krieges und Jahre später Gegenstand einer absurden Debatte über die „Fälschung“ des Fotos. Auch Karadžic, gegen den Ed Vulliamy in Den Haag als Zeuge aussagte, sparte nicht mit Hohn. Vielleicht sei der Mann schon immer so dünn gewesen, spottete er und verstieg sich in die längst widerlegte Debatte, der Mann sei gar nicht im Lager fotografiert worden, sondern davor, auf der anderen Seite des Zaunes. Mehrere tausend Menschen kamen in Lagern in der Region Prijedor und bei den Zwangsdeportationen ums Leben. Vulliamy schildert in seinem Buch „The War Is Dead, Long Live The War“ auch den Jahrzehnte langen und vergeblichen Kampf für ein Mahnmal auf dem Gebiet des schlimmsten Todeslagers. Doch die Hallen sind längst in Büros umgewandelt, die ehemalige Eisenerzmine ist wieder in Betrieb. Und da sie zur Hälfte der Republika Srpska gehört, werden ausschließlich serbische Arbeiter angestellt.
Der Hass aufeinander wird schon in der Kindheit geschürt
Das ethnische Denken ist über zwei Jahrzehnte nach dem Abkommen von Dayton, das den Krieg in Bosnien-Herzegowina offiziell beendete, immer noch die vorherrschende Kraft – und der Grund für die von keiner Seite aufgelöste Blockade der Innenpolitik. „Das Traurige ist, dass schon die Kinder erzogen werden, in ethnischen Trennungen zu denken“, sagte Marie-Janine Calic, Professorin für Süd- und Osteuropäische Geschichte an der LMU, der AZ anlässlich des 20. Jahrestages von Srebrenica. „Es gibt in Bosnien auf dem Gebiet der Föderation Schulen, da gehen kroatische und bosniakische Kinder in dasselbe Gebäude und dann lernen sie in getrennten Klassen und mit getrennten Lehrplänen unterschiedliche Wahrheiten über die Geschichte ihres Landes. Das zeigt auch, dass Versöhnung, Verständnis und einheitliche Staatsidentität von den politischen Eliten nicht gewollt sind.“
Die Schlächter von damals, die Angeklagten von Den Haag, sind heute noch Volkshelden, unter deren Fotos man in orthodoxen Kirchen Kerzen anzünden kann. Und so wundert es keinen Beobachter, dass wenige Tage vor dem Urteil gegen Karadžic ein neues Studentenwohnheim dessen Namen erhalten hat. Der Nachfolger von Karadžic an der Spitze des serbischen Teilstaates in Bosnien, Milorad Dodik, habe das neu eröffnete Wohnheim in Pale vor den Toren Sarajevos auf den Namen Dr. Radovan Karadžic getauft, berichteten die Medien am Montag. Die serbische Landeshälfte von Bosnien-Herzegowina wolle damit ihren Gründervater ehren, begründete Dodik die Namensgebung. Ed Vulliamy hat für sein Buch Dutzende von Überlebende der Lager, der Deportationen und des Krieges begleitet. Die Diaspora der Bosniaken reicht von Finnland über Australien bis nach Amerika, allein in St. Louis, Missouri, fanden 70 000 von ihnen eine neue Heimat.
Die Folgen des Krieges reichen bis in die Gegenwart
Fikret Alic, der Mann hinter dem Stacheldraht, ist – nach Jahren in Dänemark – wieder zurückgekehrt in seine alte Heimat, die Stadt Alici, die nun in der Republika Srpska liegt. „Wenn sie wenigstens zugeben würden, was sie getan haben, wäre es leichter für mich“, sagt er über seine serbischen Nachbarn. Alic findet – mit Unterstützung etlicher Medikamente – inzwischen wieder seinen Schlaf. Sein jüngerer Bruder aber musste in dänischer Behandlung bleiben. Nachdem er 15 Jahre erfolgreich die schrecklichen Erfahrungen verdrängt hatte, brach die Psyche zusammen, er wird wegen Schizophrenie behandelt. Ed Vulliamys Buch ist voll von solchen Schicksalen, es gibt keinen Königsweg, die Traumata hinter sich zu lassen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag war sich nach seinen ersten Urteilen noch sicher, dass die Wahrheitsfindung zwingend zur Versöhnung beitragen könnte. Für Bosnien-Herzegowina ist dieser Optimismus verfehlt. Wie Slobodan Milosevic wird auch Karadžic, Erfinder der „ethnischen Säuberungen“, in seiner Zelle in Den Haag sterben. Der Krieg aber, den er mit angezettelt hat, ist für viele mit dem Strafgerichtsurteil noch lange nicht vorbei. Volker Isfort
Ed Vulliamy: „The War is Dead, Long Live The War – Bosnia: The Reckoning“ (Vintage)