Großmoguls Irrtum: Beethovens schlechteste Werke
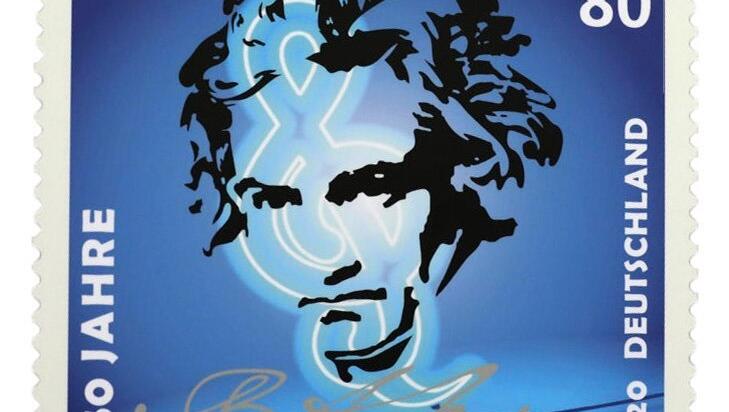
Über unser Geburtstagskind werden viele Anekdoten erzählt, aber bei einer bestimmten glaubt man, ihn direkt vor sich zu sehen. Überliefert hat sie Ferdinand Ries, Schüler, Privatsekretär und Freund, der den Komponisten respektvoll auf zwei Quintenparallelen hinwies, die sich in seinem Streichquartett Nr. 4 c-moll finden.
Solche Parallelen, muss man wissen, sind kompositionstechnische Todsünden. Beethoven wollte sich erst nicht erinnern, doch der wackere Ries schrieb ihm die Stelle aus dem Gedächtnis auf. Als Leugnen nicht mehr half, fragte der Meister unwirsch: "Nun! Und wer hat sie denn verboten?". Völlig korrekt antwortete Ries, indem er einige berühmte Musiktheoretiker aufzählte. "Und so erlaube ich sie!", antwortete Beethoven. Ende!
Josef Haydn über Beethoven: "Großmogul"
Dass sich Beethoven über alle Autoritäten hinwegsetzt, ist typisch für ihn - schon Joseph Haydn, der wiederum Beethovens Lehrer war, nannte ihn den "Großmogul". Wenn man die strittige Stelle im Streichquartett hört, stellt man fest, dass sie nicht gut klingt. Mit seinem überbordenden Selbstvertrauen lag Beethoven im Trend, hatte doch kurz zuvor der Philosoph Johann Gottlieb Fichte den Begriff des "absoluten Ich" ausgerufen, den manche Künstler allzu gerne als Freibrief missverstanden, sich als Genie zu fühlen.
Die Geringschätzung von Regeln hat jedoch ihren Preis: Wer absolut frei komponiert, läuft auch Gefahr, danebenzulangen. Hier ist eine Liste seiner sieben spektakulärsten Fehltritte, die natürlich zum Widerspruch einlädt.
"Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria"
Der erste Eintrag in das Schwarzbuch ist leicht, weil diese "Schlachtsymphonie" schon bei den zeitgenössischen Kritikern als allzu sensationsheischend durchfiel und bis heute fast vollständig ignoriert wird. Beethoven stellt in diesem symphonischen Schinken den Sieg des englischen Feldmarschalls Wellington über Napoleons Truppen in so schmerzhaft direkter Programmatik nach, als ob er mit Zinnfiguren spielen würde: Am Anfang stehen Trommelwirbel, dann kämpft ein britisches Lied gegen ein französisches, und am Schluss triumphiert "God Save the King". Dazu gibt es echten Kanonendonner!
So ein Spektakel kann auch Spaß machen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Stück eher lose gefügt als dicht komponiert ist. Uraufgeführt wurde "Wellingtons Sieg" übrigens im selben Konzert wie die Symphonie Nr. 7 A-Dur. Deren rhythmische Gewalt kann man im Lichte des martialischen Schwesterwerkes durchaus auch als Gewaltsamkeit hören.
Symphonie Nr. 1 C-Dur
Dass dieses Stück Eingang in die Liste findet, mag überraschen. Schließlich wird Beethovens symphonischer Erstling nicht nur viel gespielt, sondern genießt auch den Ruf, erfrischend frech zu sein, beginnt sie doch gleich mit einem irritierenden Dominantseptakkord. Dieser Gag findet sich freilich schon bei Haydn, und das subtiler. Schwerer wiegt, dass Beethoven diese Ankündigung eines geistreichen Komponierens im folgenden Allegro-Hauptsatz eher nicht einlöst: Das Hauptthema beginnt mit seinen penetranten Tonwiederholungen schnell zu nerven, und es hilft auch nicht, dass manche Weiterverarbeitung dadurch geschieht, dass das Motiv einfach einen Ton nach oben rückt. Solche Qualitätsunterschiede innerhalb eines Werkes kommen bei Beethoven schon einmal vor.
Duo für zwei Flöten G-Dur
Zugegeben, dieses Werklein aus den ganz frühen Jahren ist für Beethoven nicht repräsentativ, und es hat ja auch nicht einmal eine Opuszahl bekommen. Andererseits - zwei Flöten, ernsthaft? Schon Mozart hatte in einem Brief an den Vater geätzt, er würde "gleich stuff wenn ich immer für ein Instrument das ich nicht leiden kann schreiben soll". Bei Beethoven verschärft sich die Lage, weil es nun gleich zwei Flöten sind, die um die Wette tirilieren, und diese allzu hohe Konzentration durch kein drittes Instrument gemildert wird. So wirken die fünf Minuten, die das Werk gnädigerweise nur dauert, mindestens wie zehn.
33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli
Diesem eigentlich sehr bewunderten Werk haftet ein boshafter Ehrgeiz an. Denn Beethoven hat den zugrundeliegenden Walzer von Diabelli nicht geschätzt, sondern zu Recht die bloß mechanischen Motiv-Rückungen kritisiert, den vielzitierten "Schusterfleck". Er nimmt also bewusst etwas nicht so Tolles als Material, um zu zeigen, dass er - er allein! -, daraus Gold machen kann. Die Variationen entwerfen in ihrer extremen Vielschichtigkeit so etwas wie einen Katalog der kompositorischen Möglichkeiten Beethovens. Doch gerade diese Absicht fühlt man und ist, nach dem Zitat aus Goethes "Torquato Tasso", verstimmt. So vielleicht auch die Pianisten, welche die Variationen selten auf das Programm setzen.
Schauspielmusik zu "Egmont"
Laut einem Bonmot des Philosophen Theodor W. Adorno liegt hier ein "Symphoniesatz für Kinder" vor: "Manche sehr großartige Stücke Beethovens, vor allem Ouvertüren, klingen aus der Entfernung nur bum bum". Das gilt auch für die zu "Egmont". Während sie aber durchaus gespielt wird, kann man die gesamte Schauspielmusik kaum aufführen, weil sie mit ihren Liedern und Zwischenmusiken schlicht zu kleinteilig ist.
Selbst wenn gute Schauspieler am Werke sind, funktioniert der Austausch von Sprache und Musik nicht wirklich, sodass die laute "Siegessymphonie" am Schluss unvermittelt ausbricht und den Hörer erschreckt - was übrigens schon in der Ouvertüre passiert. Wie sagte doch Adorno: Bum bum...
Christus am Ölberge
Hand aufs Herz: Wer hat dieses Oratorium jemals gehört? Dabei hatte es durchaus seine Fürsprecher, etwa den Tenor Fritz Wunderlich. Drei Gründe sprechen prinzipiell gegen das ganze Unterfangen. Erstens ist Beethovens musikalische Sprache zu opernhaft für das Sujet. Dann ist Jesus Christus einfach kein Heldentenor. Und schließlich hat Johann Sebastian Bach in seinen Passionen musikalisch schon das Wesentliche zur Leidensgeschichte gesagt.
Fidelio
Die deutsche Festoper par excellence auf der schwarzen Liste? Sicherlich gibt es in dem Werk grandiose Momente, etwa den Gefangenchor, die düstere Kerkerszene und das überwältigende Jubelfinale. Doch eines ist der "Fidelio" nicht: eine Oper. Zum einen runden sich die einzelnen Elemente: komisches Singspiel und Rettungsdrama, nicht zu einem Ganzen. Vor allem aber sind Leonore und Florestan nicht, wie die Figuren in Mozarts Opern, Individuen, sondern Vertreter von Idealen, wenn auch hehren. Merke: Moral führt nicht unbedingt zu einem guten Opernstoff - so, wie Genie nicht vor Fehltritten schützt. Sehr seltenen, wohlgemerkt.


