Licht - Klang - Bewegung in der Kunst
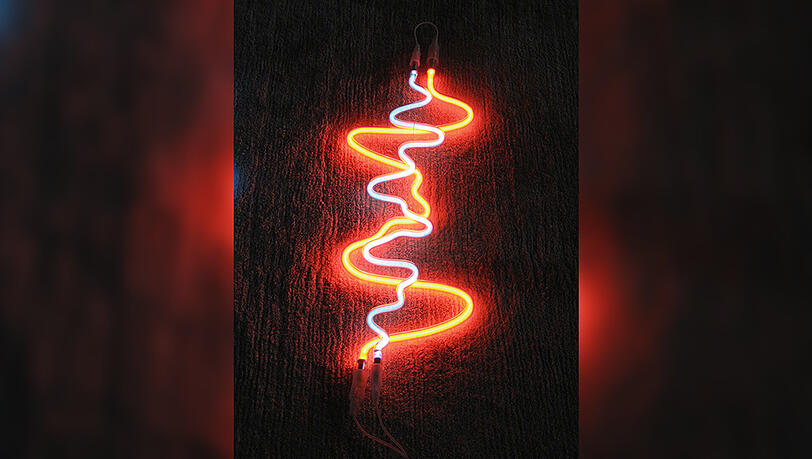
Von den Ursprüngen zur Gegenwart – eine Kurzbetrachtung
Mit den Begriffen "Licht, Klang, Bewegung" wird im Folgenden eine Kunstrichtung bezeichnet, die ihren Ursprung im Anfang des 20. Jahrhunderts hat und weitgehend identisch ist mit dem, was man allgemein unter "Kinetischer Kunst" versteht.
Kinetische Kunst
Das "Lexikon der Kunst", 1988 vom Herder Verlag herausgegeben, definiert Kinetische Kunst als eine "von Futurismus, Dadaismus und Konstruktivismus ausgehende Kunstrichtung, deren Ziel es ist, dem Kunstwerk als neue Dimensionen die Zeit, die Akustik und die optisch-räumliche Veränderbarkeit von Objekten bzw. die Technologie des 20. Jh. zu erschließen. Durch mechanische Bewegungen, akustische und lichtdynamische Effekte wird der Statik konventioneller Bildwerke und Skulpturen ein neues Element entgegengesetzt."
Eine bedeutende, wenngleich nicht unabdingbar notwendige Rolle spielt dabei die Elektrizität, da ein Großteil der beweglichen Kunstobjekte durch elektrische Motoren angetrieben werden und vor allem auch die Licht- und Klangobjekte überwiegend Strom-basiert sind.
Zur zeitlichen Abgrenzung heißt es anschaulich im Einband des 1975 im Verlag M. DuMont Schauberg erschienenen Schlüsselwerks "Die Kinetische Kunst" des 1918 in Prag geborenen, in Frankreich lebenden und lehrenden Kunsthistorikers Frank Popper: "Dieses Buch beschreibt den …Einfluss einer modernen Kunstgattung, die sich um 1920 erstmals bemerkbar machte und in den 60er Jahren ihren Höhepunkt erreichte.
Der erste Teil des Buches behandelt die Hauptbereiche der kinetischen Kunst bis zum Jahre 1970 – die optische Kunst, Maschinen, Mobiles, Werke der Lichtkinetik – und verfolgt die Entwicklung von Trompe l’oeil, hydraulischen Automaten, Androiden, …und Farborgeln bis zu den Arbeiten von Vasarely, Soto, Agam, Tinguely, Schöffer, Calder, Wilfred, Malina und den Künstlergruppen Zero, Düsseldorf, Groupe de Recherche d’Art Visuel, Paris und der Gruppe Bewegung in Moskau".
Diese Beschreibung beinhaltet neben der Nennung von Hauptströmungen und herausragenden Künstlern in diesem Zeitraum auch das Erkennen des Abflauens dieses Höhepunktes; das heißt, auch zum damaligen Zeitpunkt war bereits spürbar, dass neben den heftigen, zum Teil revolutionären Entwicklungen in Malerei und Skulptur auch in der Kinetik bahnbrechende Neuerungen stattfanden: So eröffneten die Erfindungen im elektronischen Bereich auch für die bildende Kunst ganz neue Perspektiven: Computerkunst, Electronic Art, Videokunst sind die heute (noch) gängigen Begriffe, die zur Charakterisierung dieses aktuellen Zweiges der Kinetik üblich geworden sind. Mit den folgenden Ausführungen soll versucht werden, auf einige wichtige Strömungen der kinetischen Kunst und deren herausragende Vertreter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts näher einzugehen.
Eine der ersten systematisierten Ausstellungen zur kinetischen Kunst zeigte die Pariser Galeristin Denise René Anfang 1955 ("Le Mouvement") mit Arbeiten u. a. von Agam, Pol Bury, Calder, Duchamps, Soto, Tinguely und Vasarely. Ein "gelbes Manifest" mit den Schlagworten "Farbe.Licht.Bewegung.Zeit" wurde dabei als Faltblatt verteilt (Wikipedia 2017). In Deutschland war es vor allem die von Düsseldorf ausgehende Bewegung der 1958 von den Bildhauern und Malern Otto Piene und Heinz Mack gegründeten Gruppe "Zero", zu deren Kern später Günther Uecker hinzukam, die sich der Kinetischen Kunst, der Lichtkunst und der Op Art widmete.
"Wesentliche Impulse erhielt Zero von Yves Klein, Lucio Fontana und Jean Tinguely, die selbst an Ausstellungen und Aktivitäten von Zero teilnahmen. Zum weiteren Kreis von Zero gehörten…Enrico Castellani, Piero Dorazio, Hermann Goepfert,…Piero Manzoni, Almir Mavignier (und) Christian Megert. Ihre Internationalität wurde auch durch ihr holländisches Pendant Nul …betont." 1)
Als weitere bedeutende Künstler mit dem Schwerpunkt "Kinetik" aus dem Umkreis von Zero, die zumindest zeitweise der Gruppe nahestanden, seien Siegfried Cremer, Gerhard von Graevenitz, Hans Haake, Adolf Luther, Uli Pohl und Dieter Rot genannt; auch die bisher noch nicht erwähnte Italienerin Dadamaino und ihr bisher ebenfalls unerwähnt gebliebener Landsmann Gianni Colombo, die beide über die Mailänder Gruppierung Azimut(h) der Zero-Bewegung nahestanden, sollen in diesem Zusammenhang genannt werden2).
Als ehemals wichtiges Zentrum sei auch Eindhoven erwähnt. Im dortigen Museum Stedelijk van Abbemuseum fand 1966 die bedeutende Ausstellung "KunstLichtKunst" statt, die von der dort ansässigen Firma Philips gesponsert wurde.3) Dabei lag der Fokus auf der Verwendung von Kunstlicht in Werken zeitgenössischer Künstler, darunter Alberto Biasi, Hugo Rudolfo Demarco, Dan Flavin, Lucio Fontana, Gerhard von Graevenitz, Horacio Garcia Rossi, Edouardo Landi, Julio Le Parc, Heinz Mack, Manfredo Massironi, Francois Morellet, Abraham Palatnik, Henk Peeters, Otto Piene, Francisco Sobrino, Joel Stein, Takis, Günther Uecker und Yvaral sowie die Gruppen "Equipo 57" und "Gruppo T".
Elektronische Kunst / Electronic Art
Einen entscheidenden Schritt für den Übergang vom mechanischen zum elektronischen Zeitalter in der Kunst sieht Frank Popper in der 1968 im Museum of Modern Art in New York unter dem Titel "The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age" stattfindenden Ausstellung. Dort zeigte eine Reihe von Künstlern technologisch weit fortgeschrittene Arbeiten, wie beispielsweise Yvaral, Yaacov Agam, Nicolas Schöffer, Liliane Lijn, Piotr Kowalski, Wen-Ying Tsai und Stephen Antonakos..4)
In Deutschland lässt sich gegen Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts bei einigen Künstlern in ihren Werken die fast ausschließliche Verwendung elektronischer Bauteile, u.a. von Transistoren, Speicherchips, Kondensatoren und Widerständen nachweisen, wodurch der Einsatz elektromechanischer Komponenten teilweise überflüssig wird. So nennt z.B. der Schwäbisch Gmünder Künstler und ehemalige Jazz-Musiker Walter Giers seine auf Basis dieser Bauteile entstandenen Arbeiten "Electronic Art". Diese Bezeichnung kann auch auf die Werke weiterer Künstler angewandt werden, die technisch ähnlich vorgehen, wie z.B. auf den Freiburger Licht- und Klangkünstler Peter Vogel.
Ton-Licht-Echo (Draht, Mikro, Leuchtdioden), Peter Vogel 1990 Foto: und-magazin
Videokunst
Als eine weitere in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aufkommende Ausprägung der kinetischen Kunst muss die Videokunst gesehen werden. Zwei Einflussgrößen stehen dabei im Vordergrund: zum einen eine Art Protestbewegung zum TV-Konsum als solchem, zum anderen das Aufkommen von Aufzeichnungsgeräten ("Videorekorder"), die es erlaubten, artifizielle Werke jederzeit und überall zu präsentieren.
Zu den bekanntesten Pionieren der Videokunst gehört Nam June Paik, der 1963 in der Wuppertaler Galerie Parnass 12 Fernsehgeräte mit technisch manipulierten Schirmbildern installierte. Als weitere, sehr bekannte Namen in Verbindung mit dieser Kunstrichtung seien hier Wolf Vostell, Bruce Naumann, Joseph Beuys und Robert Rauschenberg genannt. Auch der Künstler, Kurator, Kunst- und Medientheoretiker Peter Weibel, der seit 1999 das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe leitet, darf als einer der Pioniere der Videokunst gelten.5)
Es wurde oft vorgeschlagen, den Ausdruck "Videokunst" ausschließlich für solche Art Arbeiten zu verwenden. Heute jedoch umfasst er jeglichen Gebrauch des Mediums im Zusammenhang mit künstlerischer Arbeit.6) Durch die Videokunst wurde die Berücksichtigung spezieller Zeitfaktoren wie Spontaneität und Simultaneität möglich.7). Ihre Zukunft wird jedoch – wie dem Folgenden zu entnehmen ist - im engen Kontext zur Computer- und Kommunikationskunst zu sehen sein.
Computerkunst
Von kaum einer Erfindung der neueren Zeit darf behauptet werden, dass sie eine so starke Anziehungskraft auf "die Kunst" ausgeübt hat und noch ausübt wie der Computer. Dies liegt vor allem an den schon in den Anfängen vorhandenen vielfältigen künstlerischen Verwendungsfähigkeiten dieser Technik, sei es in der Musik, der Literatur oder vor allem auch der bildenden Kunst, um die es uns in dieser Betrachtung geht.
Entsprechend der anfänglichen Begrenztheit bei der Ausgabe des "errechneten" Produkts , waren es vor allem die Ausdrucke, durch die sich die Computerkunst einen Weg in die Kunstszene bahnte. "Der eigentliche Beginn der Computerkunst kann in die Mitte der sechziger Jahre datiert werden, als von einigen Programmierern (u. a. Georg Nees und A. Michael Noll) zum ersten Mal der Anspruch, Kunst und nicht nur formal interessante Grafikstrukturen zu produzieren, erhoben worden war."8) 9)
Aus diesen Anfängen heraus entstand die Computergrafik, die sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer eigenständigen Kunstrichtung etablierte und die auch heute noch in vielen Ausstellungen zu sehen ist. Eine der Pioniere, hier: Pionierin der Computerkunst, Vera Molnar, beschreibt die vier Zwecke, die – zumindest für sie - bei dieser Kunstrichtung im Vordergrund stehen, sinngemäß wie folgt10): Erstens sind es die technischen Möglichkeiten, die der Computer bietet, indem er ein quasi unendliches Spektrum an Formen und Farben bietet, besonders auch mit der Öffnung des virtuellen Raumes. Zum Zweiten kann der Computer dem Wunsch nach künstlerischer Innovation entsprechen, indem er den durch Zufall bedingten ästhetischen Schock durch Unterbrechung der Systematik und der Symmetrie erzeugt.
Ratio (Argon-Glas), 2004 Jan van Munster. Foto: und-magazin
Der Computer kann damit drittens den Geist ermutigen, neue Wege zu beschreiten. Und schließlich, viertens, kann der Computer helfen, die physiologischen Reaktionen des Betrachters zu registrieren, wie z.B. die Bewegungen seiner Augen. Durch die Weiterentwicklung der Grafik zum bewegten Bild entstand ein weiterer wichtiger Bereich: die Computeranimation, die derzeit wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Ausprägung der Computerkunst ist. Die Projektionen auf Leinwände und Gebäude sind allgegenwärtig wie auch die Vermittlung durch – vorzugsweise große – Bildschirme.
Bekannte Künstlernamen verbinden sich mit dieser Technik: Als Beispiele für zeitlich und räumlich nahe Pioniere seien Manfred Mohr, Miguel Chevalier, Philipp Geist, Julian Opie, Laurent Mignonneau & Christa Sommerer sowie Hajo Drott genannt. Aufgrund des Zusammenwachsens diverser Techniken der Computerkunst sowie deren Weiterentwicklung zu weiteren Kunstformen wie z.B. Roboterkunst, Netzkunst, Softwarekunst darf man sich der in Wikipedia zu findende übergeordnete Ausdrucksweise "Digitale Kunst" anschließen.
Schlussbemerkung
Selbstverständlich kann eine solche kurze Betrachtung nur Basisinformationen und Denkanstöße zum Titel geben. Ganze Zweige der kinetischen Kunst, die Bücher füllen, müssen hier unausgeführt bleiben. Als Beispiele seien abschließend "Laser und Holografische Kunst", "Kommunikationskunst" und auch "Filmkunst" genannt. Mit der Verinnerlichung der Anregung für den Leser, den Spuren der kinetischen Kunst in Ausstellungen, Museums- und / oder Sammlungspräsentationen nachzugehen, wäre das Ziel des Autors erreicht.
ars-technica 7 in Unterhaching vom 28.04.2017 - 01.05.2017
Anmerkungen:
1) Lexikon der Kunst, Herder 1990, Bd. 12, S. 332
2) vgl. z. B.: R. Damsch-Wiehager (Hrsg.), Zero Italien, Cantz Verlag 1995
3) vgl. z. B.: Frank Popper, Art of the Electronic Age, Thames and Hudson Ltd 1993, S. 12 f
4) ebenda S. 20 ff
5) vgl. ebenda S. 74 f
6) vgl. ebenda S.59
7) vgl. ebenda S. 77
8) Lexikon der Kunst, Herder 1990, Bd. 3, S. 260
9) Zur Geschichte der Computerkunst, die neben den Digital- auch die Analogrechner mit einbezieht, vgl. z. B. Frank Popper, Art of Electronic Age, a.a.O., S. 78 sowie die Publikationen von Herbert W. Franke, einem weiteren Pionier der Computerkunst (z. B. Computer Graphics – Computer Art, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1985)
10) vgl. ebenda S. 80


