Hans Pleschinski über "Der Flakon"
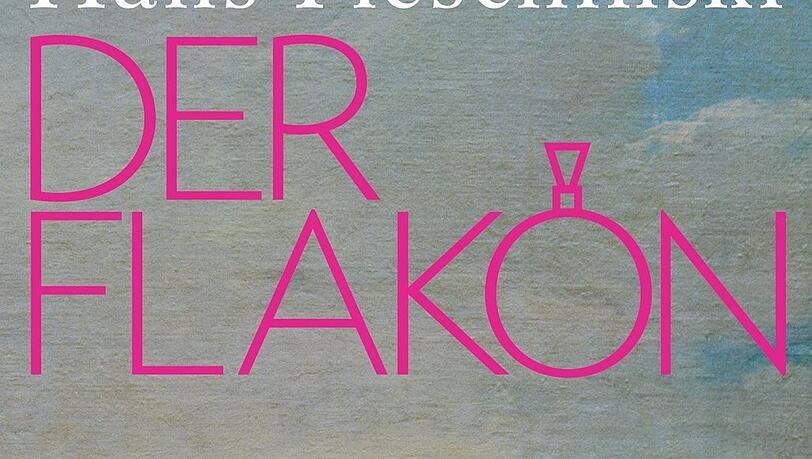
Der Titel "Der Flakon" mag Leseerwartungen schüren, die in Richtung von Patrick Süskinds "Parfum" tendieren, und tatsächlich reist auch Hans Pleschinski in seinem neuen Roman ins 18. Jahrhundert. Hier aber enden die Gemeinsamkeiten, denn im titelgebenden Flakon der sächsischen Reichsgräfin von Brühl, schillernde Protagonistin des Romans, ist keine betörend duftende Substanz, sondern Tufania, eine geruchslose Mischung aus Belladonna, Arsen und Blei. Ein paar Tröpfchen davon in einer Tasse Schokolade könnten das Leben Friedrich des Großen beenden, doch dafür müsste die Reichsgräfin erst einmal jemanden finden, der ohne Verdacht zu erwecken in die Nähe des von ihr so verhassten Preußenkönigs kommen könnte.
Mit "Der Flakon" entführt Hans Pleschinski den Leser in ein weniger bekanntes Kapitel deutscher Geschichte. Sein geistreicher und - trotz düsterer Thematik - auch vergnüglicher Roman ist historischer Krimi und Kulturgeschichte mit flirrenden Dialogen und vielen ironischen Anspielungen auch auf die Jetztzeit.
AZ: Herr Pleschinski, Sie suchen ja immer nach verborgenen Schätzen in der deutschen Geschichte. Warum jetzt ein Roman über das Attentat auf Friedrich den Großen?
HANS PLESCHINSKI: Den Plan zu diesem Buch hatte ich seit 50 Jahren. Mit 16 habe ich sogar schon einmal angefangen zu schreiben. Das Thema war für mich natürlich zu komplex, aber ich habe damals schon ein paar Seiten in der Klasse vorgelesen.
Was war denn als Schüler das Schlüsselerlebnis für solch ein entlegenes Sujet?
Als Kind wurde ich in den Schulferien aus der Lüneburger Heide oft nach Dresden zu Verwandten geschickt und war zutiefst beeindruckt von der Musenstadt und dieser Kopplung aus Schönheit und damals noch Zerstörung. Die resultierte natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg, aber dann erfuhr ich, dass Friedrich II. Dresden schon einmal, nämlich 1760 vernichtend bombardiert hatte. Ein Drittel der Stadt war zerstört. Das fand ich so unfasslich, dass ich in mein Geschichtsbuch unter das Porträt von Friedrich dem Großen "Das Schwein" geschrieben habe.
Und so begann Ihr Interesse für die Geschichte Sachsens?
Ja, ich habe Bücher über sächsische Geschichte gelesen wie andere Karl May. Sachsen war im 18. Jahrhundert die mit Abstand wichtigste Kulturregion in Deutschland und führend in der Musik, in der Literatur, in der Baukunst. Und ich fragte mich, warum davon nicht mehr so viel übrig geblieben war. Die Antwort liegt im siebenjährigen Krieg. Es geht im "Flakon" durchaus um das Schicksal Deutschlands.
Was meinen Sie konkret damit?
Ein wichtiger Wendepunkt der deutschen Geschichte war der Herbst 1756, die Kapitulation der sächsischen Armee vor den Preußen. Wenn die nicht kapituliert hätte, wäre die deutsche Geschichte völlig anders verlaufen, alles Preußische wäre nicht so dominant geworden, alles Militaristische hätte nicht so triumphiert. Dieser Weichenstellung wollte ich im Roman nachgehen und mit dem Giftattentat auf Friedrich II. verbinden.
Wie historisch gesichert ist denn das Giftattentat und die Beteiligung der Protagonisten?
Der preußische Hofchronist Graf Lehndorff erwähnt das Geschehen, aber sonst gibt es nur wenige Hinweise, denn die Sieger schreiben die Geschichte und erzählen nicht gerne von den dunklen Stellen. Friedrich II. wird den Teufel getan und zugelassen haben, dass über einen versuchten Tyrannenmord berichtet wurde.
In Ihrem Roman hat die sächsische Reichsgräfin von Brühl Friedrichs II. Kammerdiener Christian Friedrich Glasow angestiftet, den König zu vergiften.
Sie ist die glaubhafteste Person. Eine reiche, vornehme und kluge Frau, die sich entschließt, den König von Preußen vergiften zu lassen, angesichts der Zerstörung, die er über Sachsen gebracht hat. Ihr eigenes Leben ist zerstört, ihr Mann, der 34 bezahlte Ämter in Sachsen hatte, lebt im polnischen Exil, seine zahlreichen Schlösser sind verwüstet. Sie wollte auch nicht, dass ihre fünf Söhne ins preußische Militär gesteckt werden. Glasow wiederum wurde lebenslang eingekerkert, starb aber schon ein Jahr später in Spandau. Die Reichsgräfin von Brühl wurde des Landes verwiesen. Es gibt also einen wahrscheinlichen Zusammenhang. Sie forschte übrigens auch nach anderen möglichen Attentätern.
Warum hasste Friedrich II. Sachsen so sehr und insbesondere das Ehepaar von Brühl?
Friedrich II. wollte dieses glanzvolle Leben der von Brühls nicht dulden - auch aus Neid. Als junger preußischer Kronprinz hatte er Dresden erlebt und war dort regelrecht aufgeblüht gegenüber der Kindheit unter dem strengen Soldatenkönig zu Hause. Dresden war das Paradies, das er nicht hatte und haben konnte. Friedrich II. raubte nach der sächsischen Kapitulation 700 Wagenladungen Meissner Porzellan, die nach Preußen geschafft wurden. Er plünderte die Brühlsche Bibliothek und beschlagnahmte dessen Gemäldesammlung. Als er bankrott war, verkaufte er die Sammlung an Katharina die Große. Die Brühlschen Gemälde bilden die Grundlage der Eremitage in Sankt Petersburg. So schwappte der sächsische Kulturüberschwang schließlich bis an die Newa.
Friedrich II. komponierte, spielte Flöte, warum machte er nicht Preußen zur Kulturnation?
Er war eine äußerst zwiespältige Person. Als Intellektueller ist er grandios, ich habe ja auch seinen Briefwechsel mit Voltaire übersetzt. Aber als Kriegsherr ist er furchtbar. Das kulturelle Leben in Preußen bahnte sich schon an, die Berliner Oper wurde gebaut, aber die Dominanz hatte das Militär. Jeder fünfte Untertan war im Militär, die Ressourcen des Landes flossen zu 80 Prozent ins Militär. Erschütternd ist auch, dass Friedrich II. die Zukunft seines Landes im Grunde genommen gleichgültig war. Er hatte mit seinem Minister verabredet, dass im Fall seines Todes, Frieden zu schließen oberste Priorität habe, egal unter welchen Bedingungen. Preußen hätte dabei auch zerschlagen werden können. In diesem Punkt war Friedrich II. ein Nihilist.
In Sachsen hingegen wurde die Armee vernachlässigt?
Die sächsische Armee war die einzige in Europa, die komplett mit Perücken ausgestattet war. Das war schick, half aber nicht im Kampf. Insgesamt floss der sächsische Reichtum in Prachtbauten und Kultur, am Militär wurde gespart. Und dann kam das, was Putin mit der Ukraine machte.
Die Parallele drängt sich beim Lesen unweigerlich auf.
Ein Überfall ohne Kriegserklärung war ein No-Go, aber Friedrich II. tat es. Ich habe den Roman zwei Wochen vor Putins Überfall auf die Ukraine begonnen, und wir erleben plötzlich etwas Ähnliches.
Ihr vielschichtiger Roman thematisiert keinesfalls nur das Kriegsgeschehen, es geht vor allem um die kulturgeschichtliche Blütezeit.
Unsere Wahrnehmung beginnt bisweilen mit Goethe. Alles was davor ist, halten wir für unfertig und mittelmäßig. Das ist es nicht. Bei mir hat zum Beispiel der Dichter Christian Fürchtegott Gellert seinen Auftritt. Er war der erste deutsche Volksdichter, Beethoven hat ihn vertont. Auch dem Ehepaar Gottsched setze ich ein Denkmal. Luise Gottsched hat das deutsche Theater sehr erfrischt, ihre Komödie "Die Pietisterey im Fischbein-Rocke" ist heute noch sehr lustig zu lesen: Es geht um religiösen Wahn und das Thema ist zeitlos. Und Johann Christoph Gottsched, der oft als strenger Systematiker, der die Fantasie abtötet, verrufen ist, verdanken wir die deutsche Grammatik. Auch seine Stücke wurden überall gespielt. Ich ertrage es einfach nicht, wenn Menschen, die so viel geleistet haben, von der Nachwelt ins Dunkel geschoben werden.
Sie singen auch ein Loblied auf die viel verspottete deutsche Kleinstaaterei.
Das Bild der Deutschen vom früheren Deutschland ist meistens falsch. Es wird auch in der Geschichtsschreibung häufig gesagt, dass die "1000 Jahre Deutschland" bis hin zu Napoleons Neuordnung eine Fehlentwicklung gewesen seien, das ist absurd. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen war ein hochkompliziertes, sehr großes, multinationales Reich - mit Dänen, Tschechen, Italienern, vielen anderen Völkern und Deutschen. Und es funktionierte, weil es den deutschen Reichstag gab, eines der frühen Parlamente der Welt. Da war der Diskurs über Rechte erheblich weiter ausgearbeitet als in anderen Staaten. Jeder Untertan in Deutschland konnte seinen Fürsten verklagen, das gab es nirgendwo sonst auf der Welt. Friedrich der Große zerbrach dieses System und wurde deswegen mit der Reichsacht bedroht, man hätte ihn töten dürfen.
Wie sattelfest waren Sie für den Ausritt ins Rokoko?
Man muss trotz Vorwissen enorm viel recherchieren: Die Reichsgräfin Brühl sollte im Roman mit der Postkutsche im Winter von Dresden nach Leipzig fahren. Also habe ich im Verkehrsmuseum in Dresden angerufen und nach den damaligen Poststationen gefragt. Die haben mich weitervermittelt an Herrn Kaiser, den Vorsitzenden der Fördergesellschaft sächsische Postmeilensäulen. Er erzählte mir dann, dass im Krieg die Nachtfahrt wegen mangelnder Fackelläufer nicht möglich gewesen wäre. Ich musste auch meine Vorstellung von der Postkutsche über Bord werfen.
Warum?
Die meisten Verkehrstoten gab es durch hölzerne Kutschen. Bei Achsenbruch oder Wagenradbruch schlugen die Fahrgäste mit dem Kopf gegen die Wand oder die Decke und konnten sich das Genick brechen. Die Sachsen waren moderner, sie hatten Kutschen aus Weidengeflecht. Herr Kaiser empfahl mir das "Lexikon kursächsische Postmeilensäulen", das in der DDR herausgegeben worden war, eine unglaublich spannende Kulturgeschichte. Sachsen hatte unter August dem Starken überhaupt erst angefangen auszumessen, wie weit die Städte voneinander entfernt waren. Eine deutsche Pioniertat. Und Graf von Brühl ließ später die Straßen erneuern und befestigen - auf denen die Preußen dann leider bestens in den reichen Nachbarstaat vorrücken konnten.
Hans Pleschinski: "Der Flakon" (C.H. Beck, 360 Seiten, 26 Euro)


