Die neue Ausstellung "Tanzen mit dem Feind" in der Pasinger Fabrik

Paul Glaser bohrt die letzte Schraube in das Ausstellungsstück, ein altes Klavier. Musik spielte eine große Rolle im Leben seiner Tante, der niederländischen Tanzlehrerin Roosje Glaser. Die Ausstellung in der Pasinger Fabrik, in der Paul Glaser gerade noch die letzten Vorbereitungen trifft, erzählt ihre bewegende Geschichte.
Es geht um ihre erste Liebe, zu einem Piloten, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Um ihre Ehe mit einem Tanzlehrer, der sie später verraten sollte, weil sie Jüdin war. Um ihre Gefangenschaft im KZ in Auschwitz, wie die Nazis sie dort zwangssterilisierten und wie sie dort für einen SS-Offizier tanzte.
All das ist gut dokumentiert, weil Roosje Glaser gerne fotografierte und Tagebücher schrieb. Auch im KZ in Auschwitz, da schrieb sie mit Bleistift ihre Gedanken in ein kleines Büchlein. Später nahm sie es mit auf den Todesmarsch.

Ihr Neffe Paul Glaser hat ein Buch über ihr Leben geschrieben, das als Grundlage für die Ausstellung dient. Die Informationen zusammenzutragen und ihre Geschichte zu erzählen, war nicht leicht. Von der Vergangenheit und dem Krieg sprach seine Familie kaum. Er ist katholisch erzogen worden, die jüdischen Wurzeln seiner Familie erahnte er erst spät - als ihn mit 35 Jahren ein Freund auf den "typisch jüdischen Familiennamen" hinwies.
Seine Eltern wollte er dazu nicht fragen. "Wenn sie etwas zu verbergen haben, werde ich nicht die richtige Antwort kriegen. Und wenn sie nichts zu verbergen haben, ist es doch ein bisschen blöd, nach 35 Jahren zu fragen", dachte sich Glaser damals, wie er erzählt.
Einmal saß er mit seiner Großmutter am Kamin zusammen. "Ich weiß, dass mein Vater Jude ist", behauptete er dann, obwohl das nicht stimmte. Er war auf ihre Reaktion gespannt - und sie bestätigte seine Vermutung.
Für Glaser war es ein Schock. Er wusste nicht viel über das Judentum und wurde neugierig. Mit diesem Wissen konfrontierte er auch seinen Vater und nannte Namen von ermordeten Onkeln und Tanten.
"Statt zu reden verharrte er regungslos und sagte nichts. Es war hoffnungslos." Erst als er gehen wollte und gerade bei der Tür ankam, fing sein Vater an, zu sprechen: "Ja, Junge, so war es. Aber behalte das Geheimnis für dich, denn früher oder später wird es gegen dich verwendet."
Sein Vater ist alt geworden, 98 Jahre. "Das war alles, was er je darüber erzählt hat", sagt Glaser. "Ich denke, dass es teilweise die Angst war. Dass man auch nach dem Krieg untergetaucht blieb. Und dass er über all das Schreckliche nicht reden konnte und seine Kinder damit nicht belasten wollte. Aber das ist eine Interpretation von mir".
Roosje Glaser, die Tänzerin, war die Schwester seines Vaters. Die beiden Geschwister hatten miteinander gebrochen, Paul Glaser wusste nur, dass er eine Tante in Schweden hatte.
Zuerst wollte er die Sache ruhen lassen, doch das gelang nicht so recht - einmal kontaktiere ihn jemand wegen seines Familiennamens, der Briefe aus dem holländischen KZ mit dem Namen Glaser gefunden hatte.
Dann besuchte er seine Tante Roosje in Stockholm doch. Zunächst weigerte sie sich, mit ihm zu sprechen, aber ihr Neffe ließ nicht locker. "Ich weiß, dass du im KZ warst. Du bist die Einzige, die noch erzählen kann, wie es damals war", sagt er damals zu ihr. Und dann erzählte sie ihm ganz offen, wie es damals war, beantwortete all seine Fragen, auch die intimen, und zeigte ihm Fotoalben.
Glaser sah zum ersten Mal seine Großeltern. Nur seinem Vater hat er erst im Nachhinein von dem Besuch erzählt, er wollte nicht mit ihm diskutieren.

1987 besuchte er mit Kollegen die Gedenkstätte Auschwitz - und stieß dort zufällig auf einen Koffer, auf dem sein Familienname "Glaser" stand. Jeder Häftling musste damals auf seinen Koffer auch das Land der Herkunft schreiben. Neben dem Namen stand da noch "Niederlande". "Als ich das gesehen habe, war das ein Schock. Das war für mich ein fast greifbares Zeugnis der Vergangenheit von meiner Familie."
Mit der Entdeckung in Auschwitz änderte sich für Paul Glaser etwas: Er hatte das Gefühl, die Geschichte erzählen zu müssen. Und so entschloss er sich, den Rat seines Vaters "das Geheimnis für sich zu behalten" zu ignorieren.
Er erzählte seinen Freunden davon, suchte in Archiven Zeugenaussagen und Polizeiprotokolle zusammen - und schrieb schließlich das Buch über das Leben seiner Tante. "Die Tänzerin von Auschwitz" erschien 2015. "Eigentlich hat Roosje das Buch geschrieben. Es sind Teile ihres Tagebuchs und einige Briefe sind darin", sagt Glaser.
Sein Vater wollte das Buch nicht lesen. Aber als er beim Durchblättern Bilder von seinen Eltern entdeckte, die aus Roosjes Fotoalben stammten, zeichnete sich ein Lächeln auf seinen Lippen ab.
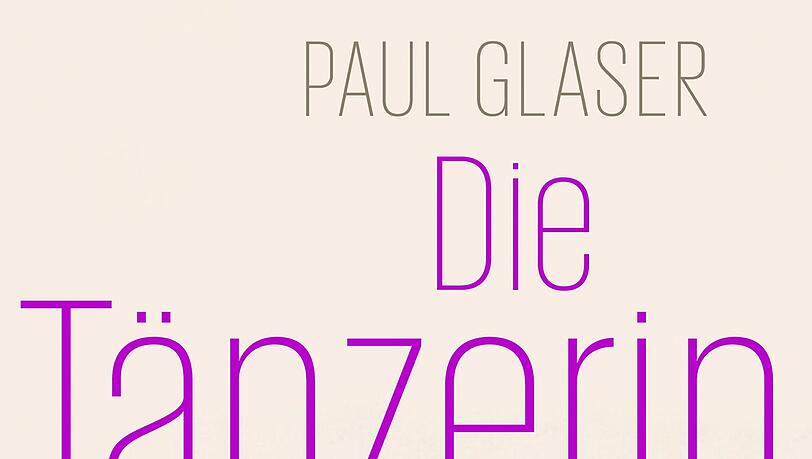
Aus dem Buch ist schließlich eine Ausstellung in den Niederlanden entstanden.
Sie war zunächst in holländischen Städten zu sehen, dann kam sie auch nach Deutschland, nach Osnabrück, Magdeburg, Braunschweig - und jetzt nach München. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut, mit Videos, Tafeln und Musik.
Roosje ist im Jahr 2000 mit 86 Jahren gestorben. Dass ihr Neffe ein Buch über sie geschrieben hat, erlebte sie nicht mehr. "Sie hätte das bestimmt schön gefunden", schätzt Glaser. Und er findet es schön, dass es in Deutschland zu der Ausstellung auch ein Begleitprogramm gibt, etwa mit Tanz und Musik - weil sie Tanzlehrerin war.
"Ich hoffe, dass diese Ausstellung auch zeigt, was es bedeutet, wenn man nicht in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie lebt. Und wie wichtig es ist, einen starken Charakter zu entwickeln und seine eigenen Entscheidungen zu treffen, unabhängig von der Gruppe."
"Tanzen mit dem Feind",
Pasinger Fabrik, bis 19. Mai
(Di bis So, 16 - 20 Uhr)
Begleitprogramm, etwa szenische Lesungen und Tanzunterricht, unter pasinger-fabrik.de


