Reaktorhalle: "Die Baugrube" der Bayerischen Theaterakademie
Die alte Reaktorhalle ist ein Relikt einer gescheiterten Utopie: ein nie vollendeter Mini-Atomreaktor mitten in der Stadt. Jetzt umschließt sie in ihrem Betonbrutalismus passenderweise ein Musiktheaterstück, das selbst das Scheitern einer Utopie zeigt: Andrej Platonows "Die Baugrube" - eine zeitgenössische, leicht surreale Erzählung über den brachialen Weg zum Kommunismus in der Stalinzeit, an deren Menschenfeindlichkeit jede humane Utopie aufgerieben wird.
Verdichtet wird diese Erfahrung in einem Bauarbeiterkollektiv plus einem ideologischen Leiter (Paul Frey, Bariton), der sanft, aber auch sanft retardiert gezeichnet ist. Später wird zu den Fünfen noch ein Waisenmädchen (Lilith Maxion, die auch Puppenspielerin ist) hinzutreten. In seiner kindlichen Naivität wirkt diese Nastja katalysatorisch. Aber zugleich ist sie auch Projektionsfläche für die Idee, in ihr - als bisher unbeschriebenem Blatt - den neuen sozialistischen Menschen schaffen zu können. Aber am Ende stirbt sie fiebrig in der Kargheit der Hungerjahre. Als virtuos eingesetzte Handpuppe ist Nastja junger Fremdkörper emotionale Bereicherung und Reibepunkt der Gruppe.
Der Autor war Kommunist, aber Antistalinist
Platonow (1899-1951) selbst hat - trotz vieler Veröffentlichungsverbote - auf den Sozialismus gehofft und an seinem sowjetischen Realisierungsversuch als Ingenieur aus proletarischen Verhältnissen mitgewirkt. Und wenn Fabiola Kuonen seine groteske Erzählung als Regisseurin dramatisiert und mit Musik anreichern lässt, stellt sich die Frage: Warum sollte man das heute tun?
Kuonen beantwortet diese Frage in einem Epilog, wenn die Schauspielerin Lilith Maxion das Publikum jetzt in einer studentisch saloppen Sprache direkt anspricht: Ja, der Stalinismus hätte das Projekt Kommunismus fast komplett diskreditiert. Aber wenn man heute - in ideologisch verhärteten und kapitalistischen Zeiten - wieder lernen würde, sich gegenseitig als Menschen zu sehen, wäre wieder Hoffnung. Nur haben diese wohlfeilen Sätze nichts mit der "Baugrube" zu tun, die sich mit dem Scheitern des realexistierenden Sozialismus an seiner kalten Menschenfremdheit beschäftigt. So ist der Inszenierung der Bayerischen Theaterakademie kein Bogen in unsere Gegenwart gelungen. Aber dafür ein großer Wurf bei der Darstellung der Deformation eigentlich gutmeinender, idealistischer Menschen durch den Stalinismus.

Elektronische Musik (von Marylène Salamin) begleitet das Stück von einem Balkon aus. Sie ist in ihrer reduzierten Melodik und bei ruhig treibender, gleichmäßiger Rhythmik eine gute akustische Illustration der körperlichen Bauarbeiten.
Alles ist stimmig, bis auf den Epilog zur Gegenwart
Man sieht die Schauspieler und Schauspielerinnen in uniformer erdfarbener Arbeitskleidung mit Haltegurten für Gerüstarbeiten. Und wirklich ist auf der Bühne nicht nur eine geometrische Vertiefung - die Baugrube - angelegt. Vielmehr erhebt sich aus ihr halbhoch ein Hochspannungsmast mit Isolatoren. Denn wie sagte Lenin: "Sozialismus ist Sowjetherrschaft plus Elektrifizierung!"
Und so verkabeln Jacoba Barber-Rozema, Paul Frey sowie die Studierenden der Theaterakademie Max Koltai, David Stancu und Emma Stratmann von ihm aus die Bühne mit weißen Seilen, so dass sich eine Art Fallstrick-Spinnennetz entwickelt. Der Text wird gesprochen, manchmal gesungen und oft vereinen sich die Arbeiter zu einem deklamierenden Kollektiv in einer Mischung aus Arbeiterliedanklängen und Sprechgesang ist.
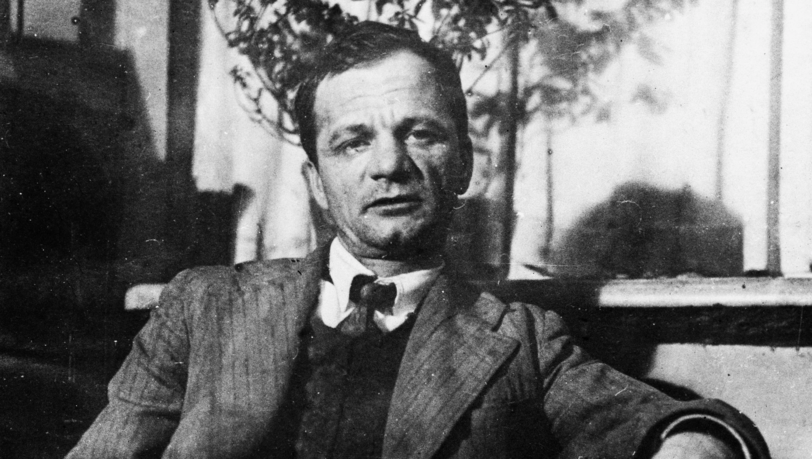
"Die Baugrube" ist Karikatur und Analyse zugleich
Dabei ist es die große Leistung des Konzeptes dieser Bearbeitung der "Baugrube", dass Form und Inhalt immer ein Ensemble bilden. Nie ragt eine Form oder eine Person zu stark heraus, alles ist stimmig zusammengehalten, inklusive der Musik: Denn verhandelt wird ja der Versuch, eine neue Arbeiterklasse als Gemeinschaft zu bilden, in der Individualismus ausgeschaltet wird. "Die Baugrube" ist dabei Karikatur und Analyse zu gleich, was die Inszenierung genau herausarbeitet: Alle sind enthusiastische sozialistische Ideenträger, aber oft blitzen biografische individuelle Erfahrungen durch, stören Melancholie und Verunsicherung den Fortschrittsglauben, scheitert alles an der Unmenschlichkeit, dass Gefühle als individualistisch und zersetzend gelten bei der Idee eines neuen Menschen in kalter materialistischen Gleichheit bishin zur paranoiden Liquidation von überall lauernden sogenannten - oft "unbewussten" - Klassenfeinden.
Platonows Text ist hier in einer Übersetzung von Gabriele Leupold zugrunde gelegt. Es ist für Zuhörer extrem anspruchsvoll, weil er eine Art sozialistischer orwellsche Neusprech ist, dessen technokratische Kälte aber durch poetischen Einsatz und Rhythmik veredelt wird, was höchste Konzentration erfordert. Aber auch wenn man in der kunstvollen Dichte nicht alles dechiffrieren kann, entsteht ein schlüssiges intensives Sprachrauscherlebnis mit sozialistischem Befremdungseffekt.
So erlebt man einen ungewöhnlichen, fordernden, aber nie stressenden Abend, der - bei aller inszenatorischen Klarheit - viele Möglichkeiten des Theaters einbringt und ausschöpft und so nachdenken lässt über die so grausam gescheiterte Utopie des Sozialismus.
wieder an diesem Samstag, 19.30 Uhr, Reaktorhalle, Luisenstraße 37 a (Königsplatz), Theaterakademie.de, 17/8 Euro
- Themen:









