Matthias Heine über Jugendsprache: "'Krass' ist schon 250 Jahre alt"

AZ-Interview mit Matthias Heine: Der Journalist und Autor aus Berlin, 1961 geboren, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Jugendsprache und hat jetzt das Buch "Krass - 500 Jahre deutsche Jugendsprache" herausgebracht.
AZ: Herr Heine, Jugendsprache hat oft einen eher schlechten Ruf bei den älteren Generationen. Wie sehen Sie das?
MATTHIAS HEINE: Die Besorgnis um die Jugendsprache ist zu großen Teilen unbegründet, wenn man weiß, dass es sie schon immer gegeben hat und die deutsche Sprache daran nicht zugrunde gegangen ist. Vielmehr ist sie durch unglaublich viele Wörter aus der Jugendsprache bereichert worden. Problematisch wird es natürlich dann, wenn jemand gar nicht mehr in der Lage ist, anders zu sprechen und sich nicht mehr aus dem Jugendjargon befreien kann.

Sie umreißen in Ihrem Buch 500 Jahre Jugendsprache in Deutschland. Was ist der älteste Nachweis?
Der erste Beleg ist aus Luthers Tischreden. Es gibt eine Stelle, in der er einen Gast zum Trinken auffordert. Er reicht ihm ein großes Glas, das man sich eher als Humpen vorstellen muss. Dabei benennt er die unterschiedlichen Füllstufen des Glases mit Ausdrücken der Theologie wie Vaterunser, den zehn Geboten und so weiter. Das ist ein bei Studenten typisches Trinkritual gewesen - sich gegenseitig unter den Tisch zu trinken. Dabei wurden die Stufen eines Glases mit eben solchen theologischen Begriffen bezeichnet, weil Theologie damals das Standard-Studium war. Und Luther hat sich dabei offenbar an seine Studienzeit erinnert.
Bis Anfang des 20. Jh. war Jugendsprache eine elitäre Angelegenheit
Mit Alkohol hat auch eine andere Wortschöpfung der frühen Studenten zu tun, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben.
Bier war ein zentrales Schmiermittel des sozialen Lebens. Entsprechend ist bier- als Verstärkungsvorsilbe in studentischen Ausdrücken aufgetreten. Biereifer und bierernst etwa.
Die Studenten bekommen viel Raum in Ihrer Kulturgeschichte. Warum?
Der Begriff Jugendsprache an sich hat sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet. Vorher hat man immer nur die einzelnen Phänomene wie Schüler- und Studentensprache betrachtet. Zudem haben sich vorher große Teile der Jugend gar nicht in irgendeiner Weise schriftlich artikulieren können, wie die Handwerksburschen oder die Bauernjungen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts ist es deswegen eine relativ elitäre Angelegenheit unter Studenten und Gymnasiasten gewesen, von denen wir schriftliche Belege haben. Im Grunde hat sich die Studentensprache über Jahrhunderte hinweg sehr stabil gehalten und deswegen sind viele ihrer Begriffe letztlich auch in die Standardsprache eingegangen. Pech oder pumpen zum Beispiel. Es gäbe Hunderte dieser Begriffe.
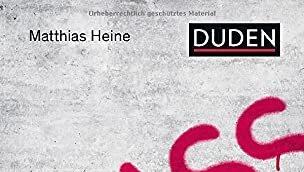
Was ist Ihr liebstes Wort aus dieser frühen Jugendsprache?
Ich mag den Luftikus sehr gerne. Wie kreativ die jungen Menschen damals mit Sprache umgegangen sind: Sie haben eine lateinische Endung angehängt und damit einen lustigen Zwitter aus Latein und Deutsch geschaffen. Ähnlich funktioniert der Pfiffikus oder der Schwachmatikus.
Warum formen junge Generationen immer wieder ihre eigene Sprache?
Es geht einerseits darum, eine Art Gruppenidentität nach innen zu schaffen. Man erkennt sich sozusagen daran, dass man die gleiche Sprache spricht. Das passiert nicht bewusst, es steckt kein Programm dahinter. Andererseits grenzt man sich damit nach außen von den Erwachsenen ab, die man damit auch etwas provozieren möchte.
Zur Jugendsprache gehört eine gewisse Jugendlichkeit
Könnte ich als Erwachsener nicht einfach auch die Jugendsprache erlernen und damit zu den ewig Jungen gehören?
Das hat natürlich ein hohes Peinlichkeitspotenzial, wenn Erwachsene so reden. Zur Jugendsprache gehört eine gewisse Jugendlichkeit. Wobei man auch sagen muss: Die Phase der Jugend ist extrem verlängert im Gegensatz zu früher. Mit 50 ziehen wir uns noch jugendlich an, tragen Turnschuhe, hören Popmusik. Jetzt vielleicht nicht Armin Laschet, aber bei uns am Prenzlauer Berg beobachte ich das schon.
Manchmal graben die Jungen auch alte Begriffe wieder aus und nutzen sie um. Das Wort "krass" etwa stammt gar nicht aus den 90er-Jahren, sondern ist schon rund 250 Jahre alt. Mit welcher Bedeutung?
Es gehört zu den vielen lateinischen Begriffen, die sich die Studenten angeeignet haben. Übersetzt hieß es ursprünglich fett oder dick. Damals vor 250 Jahren bedeutete es dann so viel wie naiv, dumm oder Opfer.
In welchem Zusammenhang?
Als krass oder auch krasse Füchse wurden an der Universität die jungen Studenten bezeichnet, die gerade am Anfang standen und die sozialen Regeln unter den Studenten noch nicht kannten. Sie wurden veräppelt, mussten den älteren Studenten die Rechnung bezahlen und so weiter. In den 90ern kommt das Wort krass mit der Techno-Szene in der heutigen positiven Bedeutung toll, prima oder geil wieder auf. Deswegen habe ich mein Buch auch so genannt, weil es eine Klammer zwischen der Jugendsprache von damals und heute ist.
Früher haben die Jungen Latein und Französisch eingebaut, das Wort hip kommt sogar aus dem Senegal. Heute deutschen sie vieles aus dem Englischen ein. Also gar nicht ungewöhnlich?
Nein. Wie Jugendliche damit umgehen, hat ja etwas unglaublich Kreatives. Hip ist natürlich einen sehr weiten Weg gegangen. Von Xippi (Anm. d. Red.: gesprochen chippi mit hartem ch) aus dem Senegal in die USA und dann zu uns. Davon ausgehend bilden sich die Wörter hip, Hippie, Hipster. In meinen Augen ist toll, wie kreativ Jugendliche im 20. Jahrhundert mit Anglizismen umgegangen sind.
Ein Beispiel?
In den 40er Jahren kam das Wort hotten auf. Das eindeutig englische Wort hot, das damals gleichbedeutend mit Jazz oder Swing gebraucht wurde, wird zum deutschen Verb. Das zeugt auch von einem bewussten und ironischen Umgang - anders als Anglizismen in der Werbesprache, die oft so etwas Blödes, Unreflektiertes, Distanzloses haben. Ich mache mir im Übrigen auch keine Sorgen über Ausdrücke aus den Migrantensprachen wie habibi, yalla, babo. Damit Wörter sich durchsetzen, müssen sie Benennungslücken schließen, also eine andere Konnotation besitzen, als es sie im Deutschen schon gibt. Sonst sind sie auch nicht erfolgreich.
"Ich bedaure, dass das Wort 'Konsumtrottel' aus der Mode gekommen ist"
Nun hat die Jugend von heute schon über ein Jahr Corona-Pause in Sachen persönliche Treffen und Kommunikation hinter sich. Wie wird das ihre Sprache beeinflussen?
Ich glaube tatsächlich, dass es keinen großen Einfluss haben wird. Denn auch schon in den letzten 20 Jahren war die Jugendsprache weniger geprägt von Ausdrücken, die in direkter mündlicher Kommunikation erfunden wurden, sondern stark beeinflusst von Sozialen Netzwerken, medial vermitteltem Hiphop-Jargon und der Gamer-Szene.
Welches Wort aus Ihrer eigenen Jugend vermissen Sie?
Ich bedaure, dass das Wort "Konsumtrottel" aus der Mode gekommen ist. So nannten wir damals Altersgenossen, die nur fürs Kaufen lebten und die auch sonst allzu konform waren. In der Ablehnung der Konsumgesellschaft waren sich ja Hippies und Punks einig. Heute scheint es so, dass selbst linke und woke Jugendliche das eigene Konsumverhalten kaum noch kritisch reflektieren, und in der Hiphop-Kultur oder bei den Instagram-Influencern ist Konsum fast eine Ersatzreligion. Ein Ausdruck wie "Konsumtrottel" könnte da helfen, kritische Distanz zu schaffen.


