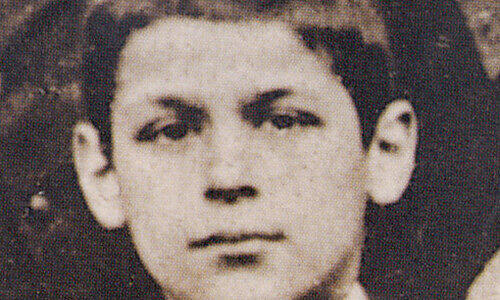Mit gepumptem Geld wurde er zum Kurzwaren-Teilhaber
Gleich nach dem 1. Weltkrieg kauft sich Gustav Schickedanz mit 15000 Goldmark bei seinem Chef ein – Bis zu Gründung der ersten eigenen Firma mit drei Mitarbeitern dauerte es dann nicht mehr lang
FÜRTH Sein Schulbesuch erfolgte „regelmäßig“, sein Betragen – so notierten der königliche Ministerial-Kommissär und der Rektor der „Königlich Bayerischen Realschule mit Handelsabteilung in Fürth“ - sein Betragen war „sehr gut“, Aufmerksamkeit und Fleiss „groß“. Unter der Rubrik „Maß der erreichten Kenntnisse“ hieß es im Abschlusszeugnis des Gustav Schickedanz allerdings nur lapidar: „Den Anforderungen entsprechend“.
Viel Zeugnisgeld wird es für den Absolventen der Mittleren Reife im Juli 1911 nicht gegeben haben: kein Einser, kaum Zweier, reichlich Dreier. Schickedanz-Biograph Theo Reubel-Ciani hatte im Strafregister des Realschülers Gustav Schickedanz ermittelt: jede Menge Verweise und Arreste wegen Unfugs, Unruhe vor dem Unterricht, Schwätzen, Heft vergessen, Abschreiben und „Übersetzung ins Buch geschrieben“. Reubel-Ciani: „Die Eintragungen beweisen nichts anderes, als dass es sich um einen ganz normalen, lebhaften Jungen gehandelt hat, fern von Streberei oder gar Duckmäusertum.“
Einer seiner engsten Freunde während der Schulzeit ist Ernst Spear, Sohn einer der erfolgreichsten jüdischen Unternehmer in Fürth. Nach der Realschule tritt Gustav Schickedanz bei dem Spielehersteller J. W. Spear in Nürnberg-Doos eine kaufmännische Lehre an. Es ist jene Firma Spear, die sich der Fotohaus-Gründer Hanns Porst nach den Juden-Pogromen im November 1938 für einen Spottpreis einverleibt hat.
Der Kaufmannsgehilfe muss an die Front nach Frankreich
Gustav Schickedanz lernt den blutigen Ernst des Lebens kurz nach dem Ende seiner Lehrzeit kennen. Als er seine einjährige Militärzeit in Nürnberg beim Infanterie-Regiment 21 beendet, macht Deutschland mobil – der Weltkrieg bricht aus. Der Kaufmannsgehilfe Gustav Schickedanz muss mit seinem Regiment an die Front nach Frankreich.
Nach einer Verwundung ist er nur noch für den Dienst in der Heimat tauglich, er wird in die Zahlmeisterei des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr versetzt. In den Revolutionswirren nach dem Krieg agitiert er kurzfristig auf ihm eher wesensfremdem Terrain, als Soldatenrat der Revolution. Erst 1919, ein halbes Jahr nach Kriegsende, erhält er seine Entlassungspapiere.
Nur sehr selten und sehr zurückhaltend äußerte sich Gustav Schickedanz später über seine Kriegsjahre. „Sie waren verlorene Jahre.“ Aber für Resignation war damals im Gemüt des Stehaufmanns Gustav Schickedanz kein Platz frei.
Am 28. September 1919 heiratete er seine Verlobte, die Bäckerstochter Anna Zehnder aus Dambach, und fand sehr schnell auch ein wirtschaftliches Fundament für die junge Ehe: Als Angestellter der Fürther „Kurzwarenhandlung en gros Lennert“ verkaufte Gustav Schickedanz Strapsgummi, Nähnadeln, Stopfgarne, Hosenträger und Knöpfe. Nur ein paar Monate später bietet ihm sein Chef die Teilhabe an.
Beinahe wäre sein erster Halbschritt in die Selbständigkeit am Geld gescheitert. Die 15.000 Goldmark, die Schickedanz als Einlage aufbringen musste, waren ein Vermögen. Die beiden Schwestern seiner Frau streckten das Geld für den Teilhaber-Vertrag vor.
Schickedanz träumte vom großen Geschäft – und wollte seine Träume möglichst schnell realisieren. Doch seine Idee, nicht nur die Zwischenhändler zu beliefern, sondern, zu ähnlich günstigen Preisen, gleich den Endverbraucher, scheiterte – vorläufig.
Die Idee von der Handelskette für den kleinen Mann, die Idee des Konsumvereins, des Versandhauses ließ den Fürther Jung-Kaufmann aber nicht los. Trotz Inflation, trotz des schwindelerregenden Währungsverfalls – Gustav Schickedanz wollte endgültig sein eigener Herr sein. Am 7.Dezember 1922 trägt er seine eigene Firma ins Handelsregister ein: „Gustav Schickedanz, Sitz Fürth, Moststraße 35, Großhandel mit Kurzwaren“. Die Firma bestand aus einem Warenlager, aus einem Bretterverschlag mit der stolzen Bezeichnung Büro und aus drei Mitarbeitern: Ehefrau Anna, Vater Leonhard und Schwester Liesl. Es war die Zeit, als ein Laib Brot am frühen Vormittag eine Million Mark kostete und um die Mittagszeit schon eineinhalb Millionen.
Schickedanz hatte seinen Beruf gelernt: Der Chef investierte in Waren, in die Lagerhaltung und überstand die Inflation. Das Geld war kaputt, die Ware hatte überlebt. Und 1923, nach dem Ende des Geldverfalls und der Einführung der Rentenmark, hatte er noch einen festen Kundenkreis. Das Geschäft mit Knöpfen, Garn und Strapsgummi lief. Der Chef hatte inzwischen vier Lehrlinge eingestellt.
Im Januar 1927 bewarb sich ein fünfter Lehrling. Schickedanz’ Ehefrau Anna entschied sofort: Die nehmen wir. Das schüchterne Mädchen war 15, kam aus Dambach und hiess Grete Lachner. Jahrzehnte später kannte man sie auf der ganzen Welt. Als „Frau Quelle“ oder als Grete Schickedanz oder, wie es ein Bundespräsident gesagt hatte, als „die deutsche Vorzeige-Unternehmerin“.
- Themen:
- Inflation