Brauchen wir wirklich noch Zoos in Bayern? Ein Autor besucht sie – und zieht ein klares Fazit

Hans Helmreich hat keinen Zooführer geschrieben. Wer einen solchen sucht, findet ihn an jeder Tiergarten-Kasse. Der Autor und Journalist stellt in seinem Buch "Zoos in Bayern" vielmehr eine einfache, aber entscheidende Frage: Brauchen wir noch Zoos? Um sie zu beantworten, hat er im Laufe eines Jahres mehrfach die Tiergärten in München, Nürnberg, Augsburg, Straubing und Hof besucht. Das Ergebnis ist ein tiefer Blick hinter die Kulissen – und ein Plädoyer für Arten- und Naturschutz.
Im Buch geht es nicht nur um Tiere, sondern in weiten Teilen auch um Menschen. Hans Helmreich stellt Direktoren und Tierpfleger, Kuratoren und Zoo-Pädagogen Förderer und ehrenamtliche Helfer vor und fragt nach ihrer Motivation.
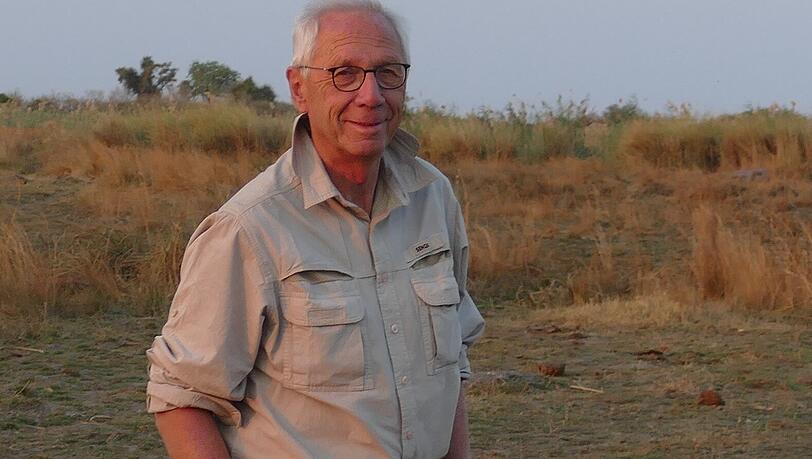
Autor auf Zoo-Besuch in Bayern: Sollte man das Geld nicht in die Herkunftsländer der Tiere investieren?
So lernt der Leser etwa den politisch denkenden Nürnberger Tiergarten-Direktor Dag Encke kennen. Der Biologe stößt immer wieder bewusst öffentliche Debatten an. Zum Beispiel aktuell, ob es ethisch vertretbar ist, überzählige Guinea-Paviane zu töten. "Wir wollen eine informierte Gesellschaft. Denn die Entscheidungen, wie Zoos langfristig arbeiten, werden nicht wir Direktoren treffen, sondern die Gesellschaft", sagt Encke.
Auf mehr als 200 Seiten begegnet man unter anderem dem Hofer Tierpfleger Lukas Blinzler, der im Rahmen des Projekts "Erinnerungstiere" mit Meerschweinchen, Hasen, Schafen oder Tauben des Zoos Senioren in Pflegeeinrichtungen besucht. Es wird die Straubinger Zoo-Pädagogin Michaela Gauderer vorgestellt, die für ihre Präparatesammlung schon mal Knochen und Schädel selbst auskocht. Oder die Münchner Artenschutzbotschafterin Christine Stark, die in Hellabrunn ehrenamtlich die Fragen von Besuchern beantwortet.
Also, wozu brauchen wir noch Zoos? In einer Zeit, in der uns Fernsehdokus spektakuläre Tieraufnahmen zeigen? Wäre das Geld nicht viel besser in den Herkunftsländern der Tiere investiert?
1. Erholung
Mehr als 40 Millionen Besucher zählen die deutschen Zoos im Jahr. Die Menschen kommen natürlich vor allem, um ein paar entspannte Stunden zu verbringen. "Nicht jeder kann nach Afrika fliegen und auf Safari gehen", sagt der Straubinger Tiergarten-Direktor Michel Delling im Buch. "Wir sind dazu da, dass die Leute auch hier ein Zebra, einen Löwen oder andere Tiere erleben können."
2. Bildung
Von der Erholung zur Bildung ist es in Zoos aber nicht weit. "Wenn die Leute mit dem gleichen Wissensstand wieder nach Hause fahren, mit dem sie zu uns gekommen sind, dann haben wir unseren Job nicht richtig gemacht", erklärt Michel Delling.
Dabei müssten es nicht immer gleich hochwissenschaftliche Erkenntnisse sein. Der Biologe freut über jede kleine Diskussion vor einem Gehege: "Wenn der Vater sagt, das ist eine Eule, und das Kind ihn verbessert und sagt, das ist ein Uhu, dann haben beide recht, denn der Uhu ist eine Eule. So etwas ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung."
Ihren Bildungsauftrag erfüllen Zoos auf vielfältige Weise. Das kann über kommentierte Fütterungen, Führungen, Vorträge oder einfach nur über eine gut gemachte Beschilderung passieren. Vielerorts gibt es Zooschulen, in denen Kinder und Jugendliche mehr über Tiere und ihren natürlichen Lebensraum erfahren. Das Angebot der neuen Tierparkschule Hellabrunn – errichtet im Stil eines alten Bauernhauses, aber ausgestattet mit moderner Technik – füllt auch mehrere Tage Schulunterricht.
3. Forschung
Zoos sind heute auch Orte der Wissenschaft. Das bedeutet zum einen, dass sich die Haltung von Tieren am aktuellen Stand der Wissenschaft orientiert. Zum anderen wird auch in Zoos Forschung betrieben. So forscht zum Beispiel der Tiergarten Nürnberg gemeinsam mit der dort ansässigen Artenschutzgesellschaft Yaqu Pache über Delfine. Dabei wurden bereits Erkenntnisse über das Verhalten von Delfinen, ihre Intelligenz und ihre Sensorik gewonnen. "Durch diese intensive Forschungsarbeit ist der Tiergarten Nürnberg zu einem internationalen Zentrum des Delfinschutzes geworden", sagt Direktor Dag Encke.
Selbst im kleinen Zoologischen Garten Hof wird geforscht. Derzeit experimentiert die Hochschule Hof dort mit einem extrem kleinen Konverter, der tierische Hinterlassenschaften vergast und verstromt.
4. Artenschutz
Alle fünf Zoos im Buch leisten einen Beitrag zum Artenschutz. "Ich betreibe quasi Tinder für Tiere", beschreibt Carsten Zehrer seine Tätigkeit. Der Zoologische Leiter in Hellabrunn ist für die rund 50 Erhaltungszuchtprogramme zuständig, an denen sich der Münchner Tierpark beteiligt.
Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Drill, einer sehr seltenen afrikanischen Primatenart. Als sogenannter Zuchtbuchführer entscheidet Carsten Zehrer, welches Tier zur Weiterzucht in welchen Zoo kommt. Ziel der Drill-Partnervermittlung ist der Aufbau einer genetischen Reserve, sollte die Art in freier Wildbahn aussterben.

Oft sind Zuchtprogramme in Zoos mit Schutzprojekten in den Herkunftsländern der Tiere kombiniert. Carsten Zehrer etwa arbeitet beim Drill mit der Organisation Pandrillus zusammen, die in Nigeria und Kamerun zwei Auffangstationen für Drille und ein 100 Quadratkilometer großes Schutzgebiet in den Afi Mountains in Nigeria unterhält.
Der Auswilderung von Tieren sind allerdings nicht selten Grenzen gesetzt: nämlich dort, wo nicht mehr genug natürlicher Lebensraum vorhanden ist. So gibt es etwa kaum Auswilderungsprojekte für Menschenaffen aus Zoos. Hans Helmreich bringt es bereits im Vorwort seines Buches auf den Punkt: "Man kann sich in Zoos nach wie vor eine schlichte Auszeit vom Tagesgeschäft gönnen, Tiere entdecken und beobachten, die Natur genießen. Aber wer will, kann Zoos heute zunehmend als breit angelegte Zentren für Umwelt- und Naturschutz erleben."
Autor Hans Helmreich: "Zoos allein können die Welt nicht retten"
AZ: Herr Helmreich, für Ihr Buch "Zoos in Bayern" haben Sie fünf bayerische Zoos mehrfach besucht. Was hat Sie dabei am meisten beeindruckt?
HANS HELMREICH: Zum einen die Leidenschaft der Menschen in den Zoos auf den unterschiedlichen Ebenen, den Tieren in ihrer Obhut ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen und den Besuchern ein breites Wissensangebot zu den naturkundlichen Zusammenhängen des Lebens zu vermitteln. Zum anderen aber auch die beeindruckenden Leistungen für den Artenschutz, die die Zoos im Verbund ihres internationalen Netzwerks erbringen.
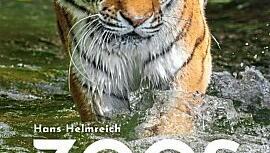
Was zeichnet einen modernen Zoo aus und inwieweit werden die bayerischen Zoos diesen Anforderungen gerecht?
Ein moderner Zoo lädt dazu ein, sich mit Tieren in ihren Lebensräumen zu beschäftigen, und thematisiert das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. Wovon leben wir? Welche Ressourcen nutzen wir? Wie können wir das Überleben vieler Tierarten sichern und die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens, besser schützen? Für Stadtmenschen ist er oft auch die einzige Möglichkeit, abgesehen von Hunden oder Katzen, überhaupt mit lebendigen Tieren in Kontakt zu kommen. Jeder der fünf bayerischen Zoos erfüllt diese Aufgaben engagiert und auf seine Weise.
Sie stellen am Anfang Ihres Buches die Frage, wozu es Zoos heute noch braucht. Wie lautet die Antwort?
Hier zitiere ich Rasem Baban, den Direktor von Hellabrunn: "Wenn es Zoos heute nicht gäbe, müsste man sie sofort erfinden." Es gibt keine andere Institution, die vergleichbar in der Lage ist, ganz praktischen Artenschutz, wissenschaftliche Arbeit und Wissensvermittlung aus einer Hand zu leisten. Trotzdem können Zoos allein die Welt nicht retten. Sie brauchen die Unterstützung durch die breite Gesellschaft und ergänzende Projekte in den Herkunftsländern bedrohter Tiere.
Dennoch stehen Zoos immer wieder in der Kritik, zum Beispiel, was die Haltungsbedingungen für exotische Tierarten betrifft. Können Sie das nachvollziehen?
Auch Zoos sind kein Paradies und konkrete, sachliche Kritik wird dort nach meiner Einschätzung sehr ernst genommen. Das Wissen um die Bedürfnisse von Tierarten wird ständig besser. Daraus resultieren oft geänderte Anforderungen an die Haltung. Aber die Umsetzung braucht Zeit und Geld. Deshalb ist es nicht immer möglich, in allen Bereichen zu jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand zu sein. Aber auch das Leben in der sogenannten freien Natur ist kein Idyll. Die Lebensräume bedrohter Tierarten sind geschrumpft und extrem gefährdet. Nationalparks und Tierreservate haben Grenzen, in denen oft Menschen die Bestände regulieren müssen. Die Aufgaben von Zoos und Naturschutzgebieten sind sehr ähnlich geworden. Deshalb ärgern mich die naiven Forderungen extremer Tierschützer, die vorschlagen, Zoos zu schließen und die Etats in die Herkunftsländer der Tiere zu geben. Das wäre das finale Todesurteil für viele Tierarten.
Was zeichnet die fünf Zoos in Ihrem Buch jeweils besonders aus? Haben Sie einen Liebling?
Die fünf von mir beschriebenen bayerischen Zoos sind sehr unterschiedlich in Größe und Charakter. Aber sie haben alle den gleichen Ansatz und die gleichen Ziele. Deshalb erscheint mir der kleinste Zoo in Hof mit seinem spannenden Entwicklungskonzept genauso wichtig wie der Besuchermagnet Hellabrunn. Meine Sympathie gehört allen fünf gleichermaßen.

